Die Wache appellierte gegen Geld an einen geschiedenen Schriftsteller
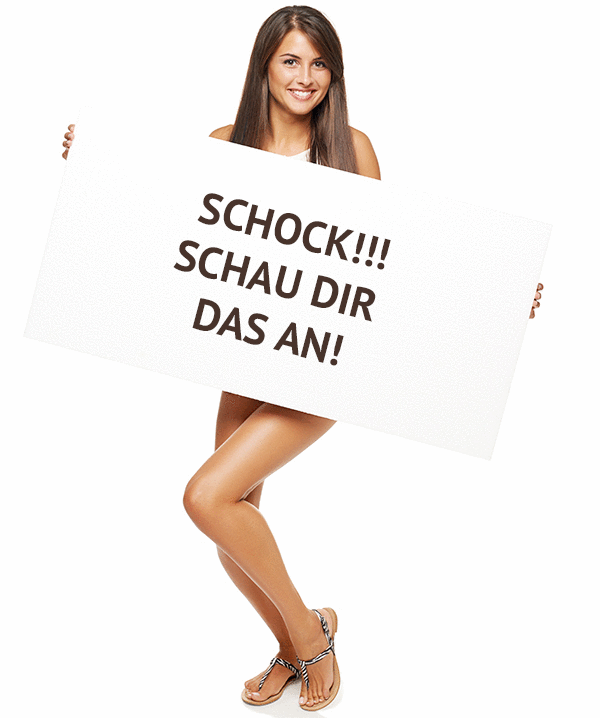
🔞 ALLE INFORMATIONEN KLICKEN HIER👈🏻👈🏻👈🏻
Die Wache appellierte gegen Geld an einen geschiedenen Schriftsteller
© Portail «Crimes des nazis en URSS», В. А. Темин
Wie Anwälte in die Falle der sowjetischen Anklage tappten
Boris Polewoi sah als einer der Ersten das befreite KZ-Lager
Keitel gibt zu, vorsätzlich Kriegsverbrechen begangen zu haben
Bei den Nürnberger Prozessen war alles neu –sie gelten auch als Geburtsstunde der modernen Simultanübersetzung. Die neue Übersetzungsmethode kam ausgerechnet vor dem Militärgerichtshof erstmals zum Einsatz. Die Weltgemeinschaft hatte sich darauf geeinigt, keine Kriege mehr und friedlich leben zu wollen. Die Dolmetscher spielten eine eminent wichtige Rolle bei der Verständigung vor Gericht. Sie hatten dabei wohl die größte Verantwortung übernommen, weil etwas mit dieser Tragweite noch nie zuvor getan hatten. Besonders schwer hatten es die sowjetischen Dolmetscher, die diese Prüfung glücklicherweise glänzend bestanden.
Völkermord. Der Plan des Dritten Reichs
Wie Anwälte in die Falle der sowjetischen Anklage tappten
Boris Polewoi sah als einer der Ersten das befreite KZ-Lager
Keitel gibt zu, vorsätzlich Kriegsverbrechen begangen zu haben
Bei den Nürnberger Prozessen war alles neu –sie gelten auch als Geburtsstunde der modernen Simultanübersetzung. Die neue Übersetzungsmethode kam ausgerechnet vor dem Militärgerichtshof erstmals zum Einsatz. Die Weltgemeinschaft hatte sich darauf geeinigt, keine Kriege mehr und friedlich leben zu wollen. Die Dolmetscher spielten eine eminent wichtige Rolle bei der Verständigung vor Gericht. Sie hatten dabei wohl die größte Verantwortung übernommen, weil etwas mit dieser Tragweite noch nie zuvor getan hatten. Besonders schwer hatten es die sowjetischen Dolmetscher, die diese Prüfung glücklicherweise glänzend bestanden.
Völkermord. Der Plan des Dritten Reichs
Mit Unterstützung von Allgemeine Informationspartner Informationspartner
Mit Unterstützung von Allgemeine Informationspartner Informationspartner
Tschechische Schauspielerin, deutscher Filmstar, Liebhaberin des Propagandaministers Joseph Goebbels. 1934 zog sie auf Einladung des Filmstudios Ufa nach Deutschland, wo sie Hitler vorgestellt wurde und ihn sehr beeindruckte, und zwar weil sie seiner ums Leben gekommenen Geliebten Angelika Rauball sehr ähnlich aussah. Baarová besuchte den Führer oft in seiner Reichskanzlei, wo die beiden unter vier Augen Tee tranken. Sie wurde zum großen Star nach ihrer Rolle im Streifen „Barcarole“ (1935). Das Filmstudio MGM in Hollywood bot Baarová einen siebenjährigen Vertrag an, doch sie lehnte diesen ab. Später behauptete sie, sie hätte noch berühmter als Marlene Dietrich werden können. Goebbels, der im Nachbarhaus wohnte, umwarb sie aktiv, und irgendwann gab sie nach. (Magda Goebbels soll ihr einen „Kompromiss“ vorgeschlagen haben, indem die beiden „Joseph teilen“ würden.) Ihr Roman fand ein Ende, als Hitler auf Magdas Betreiben sein Machtwort sagte. Goebbels reichte das Rücktrittsgesuch ein, wollte sich von Magda scheiden lassen und mit Baarová ins Ausland fliehen. Hitler lehnte sein Rücktrittsgesuch ab und verbot ihm, sich mit seiner Geliebten zu sehen. Sein Propagandachef reagierte darauf mit einem Selbstmordversuch am 15. Oktober 1938. Baarová wurde verboten, neue Filme zu drehen, und ihre früheren Filme wurden nicht mehr in Kinos gezeigt. 1941 zog Baarová nach Italien und nach dessen Besatzung durch die US-Truppen nach Prag. Im April 1945 wurde sie von den Amerikanern festgenommen. Statt der Hinrichtung für Kollaboration mit den Nazis wurde sie zu einer Haftstrafe verurteilt: Es war ihr gelungen, vor Gericht zu beweisen, dass sie in deutschen Filmen noch vor dem Zweiten Weltkrieg gespielt hatte. Während des Strafprozesses gegen Lída Baarová hat ihre jüngere Schwester sich das Leben genommen. Lída wurde von einem Bewunderer befreit, der einen Verwandten in der tschechoslowakischen Nachkriegsregierung hatte und der mit ihr nach Österreich geflüchtet ist. Die letzten 20 Jahre verbrachte Lída Baarová in der Vergessenheit und Elend in Salzburg. 1995 veröffentlichte sie ihre Erinnerungen unter dem Titel „Die süße Bitterkeit meines Lebens“. In diesem Buch erzählte sie über die Elite des Dritten Reiches und gab zu, den Roman mit Goebbels gehabt zu haben, den sie ihr ganzes Leben lang bestritten hatte.
Deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Fotografin. Sie wurde nach dem Streifen „Das blaue Licht“ bekannt. 1932 war sie von Hitlers Wahlrede fasziniert und schrieb ihm einen Brief mit der Bitte um ein Treffen. Seit der Bekanntschaft mit dem Führer bekam sie seine volle Unterstützung. Als Regisseurin drehte sie drei propagandistische Kult-Streifen: „Der Sieg des Glaubens“ (1933), „Triumph des Willens“ (1935) und „Tag der Freiheit! – Unsere Wehrmacht“ (1935). Auf diesen folgte der Film „Olympia“ (1938), dessen Premieren in den USA und Großbritannien wegen der Medienberichte über die „Kristallnacht“ scheiterten. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestritt Riefenstahl Fakten, die bewiesen, dass sie von der Massenvernichtung von aus der Sicht der Rassenlehre „minderwertigen“ Menschen gewusst hätte: Am 12. September 1939 hatte sie mit ihrem Filmstab im polnischen Końskie den Massenmord an Juden durch Soldaten der Wehrmacht beobachtet; 1940 bekam sie bei der Arbeit am Film „Tiefland“ etwa 120 KZ-Häftlinge zur Verfügung. Dabei muss sie gewusst haben, was auf diese Menschen (alle waren Sinti und Roma) wartete (und die meisten von ihnen sind später tatsächlich in Auschwitz gestorben). Riefenstahl war die bekannteste und erfolgreichste Kulturschaffende im Dritten Reich und gehörte der Nazi-Elite an. Im April 1945 wurde Riefenstahl zum ersten Mal von US-Soldaten festgenommen. Bei mehreren Entnazifizierungsprozessen wurde sie jedoch freigesprochen und nur als „Wegbegleiterin“ anerkannt. Bald darauf verließ sie die Filmbranche und fokussierte sich künftig auf die Fotokunst. Dabei bereicherte sie die internationale Kulturpraxis durch einen neuen Typ von Themen und Vorgehensweisen: Ab dem Alter von 53 Jahren fotografierte sie Menschen aus nubischen Stämmen in Afrika, und mit 71 machte sie Unterwasserfotos. 1987 wurden Riefenstahls Memoiren veröffentlicht, die zum Bestseller aller Zeiten wurden. 2001 wurde sie mit der Goldmedaille des Internationalen Olympischen Komitees ausgezeichnet. Leni Riefenstahl ist 2001 gestorben, zwei Wochen nach ihrem 101. Geburtstag. Bis zu ihren letzten Lebenstagen behauptete sie, „nicht gewusst“ zu haben.
Die weltweit bekannte französische Modeschöpferin fand sich 1940 im von der Wehrmacht besetzten Frankreich wieder. In der Nachkriegszeit entstanden erste Gerüchte über ihre Verbindung mit den Nazis. 2011 wurden die Informationen, Chanel wäre Agentin der deutschen Militäraufklärung gewesen, bestätigt. Sie war Liebhaberin des deutschen Offiziers und Abwehr-Mitarbeiters, Barons Hans Günther von Dincklage, der die Vermittlerrolle zwischen ihr und den Besatzungsbehörden spielte und ihren Wohnsitz im Pariser „Ritz“-Hotel bezahlte. Er hatte die 57-Jährige als „Agentin F-7124“ unter dem Codenamen „Westminster“ angeheuert (gleichzeitig hatte sie auch einen anderen Liebhaber, den Herzog Westminster). Dank dieser Kooperation gelang es Chanel, ihren Neffen aus einem Gefangenenlager in Deutschland zu befreien, und außerdem versuchte sie, die volle Kontrolle über das Parfümgeschäft zu bekommen (die entsprechende Lizenz hatte sie noch 1924 ihren Geschäftspartnern, den Brüdern Wertheimer überlassen, und jetzt wollte sie im Rahmen der „Arisierung“ des jüdischen Vermögens die Marke Chanel zurück haben). Sie unterstützte öffentlich die Theorie von einer jüdisch-bolschewistischen Verschwörung und war für ihre antisemitischen Aussagen bekannt. Unter anderem bekam Chanel den Spitznamen „Kollaborateurin der Horizontale“ – wegen ihrer intimen Verbindung mit hochrangigen Okkupanten. Zudem pflegte sie enge Kontakte mit dem Chef der politischen Aufklärung des Dritten Reiches, Walter Schellenberg. Chanel betrieb keine unmittelbare Spionage, half aber den Nazis dank ihren Kontakten in den einflussreichen Kreisen in Spanien und Großbritannien. Im Rahmen der „Operation Modellhut“ sollte sie separate Verhandlungen der Nazis mit den britischen Behörden voranbringen, doch der Einsatz wurde von MI6-Agenten zum Scheitern gebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg flüchtete Chanel in die Schweiz und konnte dem Gerichtsprozess wegen Kollaboration mit den Nazis entgehen. Vermutlich gelang ihr das dank der Einmischung entweder Winston Churchills oder der britischen königlichen Familie. Nach der Rückkehr nach Frankreich schmierte sie alle Zeugen, die vor Gericht Aussagen über ihre Kontakte mit hochrangigen Nazis, unter anderem mit Schellenberg, machen könnten, dem sie geholfen hatte, ins Ausland zu flüchten. Dieser bedankte sich bei Chanel, indem er sie in seinen Memoiren nicht erwähnt hat.
König Eduard VIII. und Wallis Simpson
Der britische König Eduard VIII., der vor dem Zweiten Weltkrieg als eine der glamourösen Ikonen galt, dankte im Jahr 1936 ab, um die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten, und bekam den Ehrentitel des Duke of Windsor. Bekannt ist, dass Wallis einen Roman mit dem Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop hatte (dieser soll ihr jede Nacht 17 rote Nelken zugeschickt haben); das FBI veröffentlichte Informationen, dass Mrs. Simpson Agentin Nazi-Deutschlands gewesen war, die den Zugang zu geheimen Unterlagen der britischen Regierung gehabt hatte. Das Paar machte kein Hehl aus der Sympathie für die Nazis – 1937 traf es sich mit Hitler, und auf einem Foto war Eduard beim Nazigruß zu sehen (später behauptete er allerdings, einfach mit der Hand gewinkt zu haben). 1940 hatten Eduard und Wallis enge Kontakte mit deutschen Diplomaten in Portugal, und der abgedankte Monarch erklärte in einem Interview, Großbritannien würde demnächst gegen das Dritte Reich aufgeben. 1945 entdeckten die US-Truppen schockierende deutsche Archivunterlagen, die als „Marburg Files“ bekannt wurden. Dabei handelte es sich unter anderem um die „Windsor-Akte“ mit Informationen über die so genannte „Operation Willi“ von 1940: Dabei hatte man den Duke Windsor von einer Verschwörung seines Bruders, des Königs Georg VI., und des britischen Ministerpräsidenten Churchill überzeugt, die ihn angeblich töten wollten. Angesichts dessen sollte Eduard VIII. eine Absprache mit den Nazis akzeptieren. Es war auch seine Entführung zwecks Erpressung der königlichen Familie und Kapitulation des Vereinigten Königreiches vorgesehen. Laut diesem Plan sollte Eduard auf den Thron zurückkehren, wobei man seine Gattin als Königin anerkennen würde. Dafür sollte London den ungehinderten Durchmarsch der Wehrmacht quer durch Europa akzeptieren. Die „Marburg Files“ enthalten unter anderem einen Briefwechsel darüber, dass der Herzog die Bombenangriffe gegen England zwecks Nötigung der britischen Regierung zu Friedensverhandlungen befürwortet hätte. Allerdings wollte sich die königliche Familie nicht von Eduard lossagen, und dieser hat den Rest seines Lebens gemeinsam mit seiner Frau in Frankreich verbracht, wo er 1972 starb.
1997 räumte die Firma Hugo Boss öffentlich ein, mit den Nazis kollaboriert zu haben, und um ihr Image zu retten, sponserte das Unternehmen eine wissenschaftliche Untersuchung dieser Tatsache. Dabei stellte sich heraus, dass der Firmengründer Hugo Boss Uniform für Soldaten der Wehrmacht hergestellt und dabei großes Geld gemacht hatte. In seiner Fabrik kamen Kriegsgefangene zum Einsatz – 140 Polen und 40 Franzosen. Wider die Gerüchte wurde die schwarze SS-Uniform nicht von Boss selbst, sondern vom deutschen Offizier, ausgebildeten Designer Karl Dibic, entworfen. Als sich herausstellte, dass die schwarze Farbe im Sommer das Sonnenlicht anzieht, weshalb die Militärs stark schwitzen mussten, wurde Schwarz durch Grau ersetzt. Schwarzer Stoff wurde nur für die Produktion der Paradeuniform der höchsten SS-Offiziere verwendet – und diese wurde in der Boss-Fabrik geschneidert. Hugos Sohn Siegfried räumte 2007 öffentlich ein, dass sein Vater mit den Nazis kooperiert hatte und freiwillig der NSDAP beigetreten war. Deshalb wurde seine Fabrik als ein besonders wichtiger Militärbetrieb registriert und bekam große Aufträge von der Reichsführung. Alle Firmenleiter waren überzeugte Hitler-Anhänger. Nach dem Krieg wurde Boss zu einer Strafe in Höhe von 100 000 Mark verurteilt, später jedoch teilweise rehabilitiert, so dass er nicht mehr als „Belasteter“, sondern als „Mitläufer“ eingestuft wurde. Nach der Bekanntgabe der Studienergebnisse veröffentlichte die Firma Hugo Boss auf ihrer Website eine offizielle Erklärung, in der sie die Leiden der Menschen „tief bedauerte“, die unter den Nazis in der Boss-Fabrik arbeiten mussten. In den 1990er-Jahren wurde die schwarze Uniform, die bis dahin als schönste Uniform aller Zeiten anerkannt worden war, ein Element der neuen politischen Bewegung „Nazi chic“, deren meiste Adepten den neonazistischen Kreisen in Japan angehörten.
König Eduard VIII. und Wallis Simpson
Dmitri Mereschkowski und Sinaida Gippius
Das Schriftstellerpaar Dmitri Mereschkowski und Sinaida Gippius hatten Ende 1919 aus Russland emigriert und lebten zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in Frankreich, wo sie quasi an der Spitze der Kulturkreise unter den dortigen Immigranten standen. Den Faschismus bzw. Nazismus betrachteten sie als die einzige Kraft, die imstande wäre, den von ihnen gehassten Kommunismus zu vernichten. Mereschkowski interessierte sich seit den späten 1930er-Jahren für faschistische Ideen, traf sich mit Mussolini, den er für Europas Retter vor dem Kommunismus hielt. Gippius war allerdings geteilter Meinung und lehnte jede Tyrannei ab. Dennoch hielt sie Hitler für einen Führer, der die Bolschewiken besiegen könnte. Im Sommer 1941, bald nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion, haben Mereschkowskis Freunde ihn zum deutschen Radio eingeladen, ohne Gippius darüber zu informieren. Er trat mit einer Rede auf, in der er Hitler mit Jeanne d’Arc verglich, die die Welt vor dem Teufel retten wollte, und sprach dabei von geistigen Werten, die deutsche Soldaten auf ihren Bajonetten tragen würden. Als Gippius davon erfuhr, war sie sehr empört, verteidigte jedoch weiterhin ihren Mann. Allerdings empfand sie selbst Sympathie für russische Kollaborateure, die sich für Deutschland entschieden hatten, und schrieb von „russischen Jungen, die jetzt, in den 1940er-Jahren unseren schrecklichen Jahrhunderts, einen neuen heiligen Kampf für Russland führen – neben ihren neuen Verbündeten, die sie nie verlassen werden!“ Mereschkowskis Rede wurde sofort von der russischen nazistischen Zeitung veröffentlicht. Danach wurde das Ehepaar boykottiert. Am 7. Dezember 1941 starb Mereschkowski, und kurz vor seinem Tod wurde er enttäuscht von den faschistischen Ideen, nachdem er über ihre praktische Umsetzung erfahren hatte – über die Gräueltaten der Wehrmacht auf dem Territorium der Sowjetunion wurde immerhin regelmäßig berichtet. Es war allerdings viel zu spät, und zu seiner Beerdigung kamen nur wenige Menschen, und sein Name konnte nicht mehr vom „Stempel“ des „Nazi-Anhängers“ gereinigt werden.
Als die Tagebücher des russischen bzw. sowjetischen Schriftstellers Michail Prischwin veröffentlicht wurden, wurde das zu einem herben Schlag für viele seine Anhänger: Darin hatte er offen zugegeben, Sympathie für das Hitler-Regime zu empfinden und die Kommunisten samt Juden zu hassen. Gleichzeitig betonte er, nicht zu glauben, dass die Nazis das Ziel verfolgt hätten, die Slawen zu vernichten, und zu wünschen, dass die Deutschen die Sowjetunion erobern würden. Nach Frankreichs Besatzung im Jahr 1940 schrieb er: „Die Deutschen haben die Seine erreicht. Es ist mir irgendwie angenehm, und Rasumnik (Prischwins Freund, Schriftsteller Iwanow-Rasumnik, der den deutschen Überfall auf die Sowjetunion begrüßt und gegen die Russen gekämpft hatte) ist es unangenehm; und Ljalja (Prischwins zweite Frau Valeria Liorko) hat auch seine Seite eingenommen. Deshalb ist Rasumnik auch für die Franzosen (so denke ich), weil sie jetzt gegen uns sind, wie er während des damaligen Kriegs für die Deutschen war, weil sie gegen uns waren (und es gibt niemanden, der schlimmer wäre als wir). Und Ljalja ist jetzt deswegen gegen die Deutschen, weil sie die Sieger sind, und die Franzosen tun ihr leid. Ich stand jedoch, wie aufgezäumt, für Hitler.“ „Hitlers Sache finde ich besser als die der Verbündeten, weil sie dem Prinzip ‚Ich kaufe alles‘ folgen, während ihm das Prinzip ‚Ich nehme mir alles‘ lieber ist.“ Im Frühjahr 1941 schrieb Prischwin: „Ich stehe für Deutschlands Sieg, denn bei Deutschland geht es schlechthin um das Volk und den Staat…“ 1940 und 1941: „Mein ‚Für Hitler‘ ist meine Ablehnung unserer sektiererischen Intellektuellen, aber möglicherweise auch das Ergebnis meines Glaubens, dass der Gott nicht ganz gleichgültig zum menschlichen Blut ist und Mitleid für gesundes Blut empfindet.“; „In der Gegenwart glaubt man bei uns, dass wir an den Deutschen nicht vorbeigehen können: Wir werden ihnen helfen, sie werden uns in ihre Kolonie verwandeln, und falls wir gegen sie auftreten, werden sie uns zerschmettern und in die Hand nehmen. Die Juden und alle Mitstreiter hassen Hitler von ganzem Herzen, und dieser Hass hat die halbe Welt gefüllt – von Rothschild bis zum armen russischen Intellektuellen, der mit einer Jüdin verheiratet ist“; „Das tiefe Mitgefühl des ganzen Volkes mit den Deutschen ist eine eigenartige Äußerung des russischen Patriotismus (im Sinne der Anerkennung von Rjurik)“. 1943 wurde Prischwin zu seinem 70-jährigen Jubiläum mit dem Orden des Roten Banners der Arbeit ausgezeichnet, und am 15. Februar 1945 schrieb er: „Als auf der Krim Deutschlands Vernichtung verkündet wurde, stellte sich die große Frage: Wofür sterben denn die Deutschen, worin bestand der Zweck ihres Heroismus?“ Prischwins Tagebücher wurden erst 1982 veröffentlicht, und für die Verleger wurde das zu einem richtigen Schock. Allerdings wurden sie vollständig und ohne Ausnahmen gedruckt.
Dmitri Mereschkowski und Sinaida Gippius
Die große französische Sängerin schien die deutschen Okkupanten ohne große Proteste akzeptiert zu haben. Sie gab Konzerte im Dritten Reich, trat vor französischen Kriegsgefangenen in Deutschland auf, ließ sich mit deutschen Offizieren fotografieren, bekam riesige Gagen für Nachtkonzerte für Deutsche, die beispielsweise im Obergeschoss eines Bordells stattfinden konnten. Und in einem anderen Stockwerk desselben Hauses wurden in dieser Zeit Juden versteckt, und Piafs Konzerte dienten quasi als Deckung. Der Star hat etlichen jüdischen Musikern bei der Flucht geholfen, die sich später dem Widerstand anschlossen. Und französischen Gefangenen in deutschen Lagern überreichte sie nicht nur ihre Autogramme, sondern gefälschte Unterlagen.
Der französische Sänger armenischer Herkunft Charles Aznavour trat im okkupierten Paris intensiv mit Konzerten auf und hatte viele Anhänger auch unter deutschen Soldaten. Gleichzeitig versteckte er in seiner Wohnung Juden und hat dem Helden des Widerstands Missak Manouchian geholfen. Dafür wurden Charles und seine Schwester Aida im Jahr 2017 mit der Raoul-Wallenberg-Medaille ausgezeichnet.
Die Schauspielerin Olga Tschechowa, Nichte von Olga Knipper-Tschechowa, emigrierte aus Russland nach Deutschland im Jahr 1920 und war in den frühen 1930ern schon ein Filmstar. Sie spielte in vielen Streifen bis zum Zusammenbruch des Dritten Reiches und wurde 1936 als „Staatsschauspielerin“ ausgezeichnet. Sie gehörte dem nächsten Umfeld Hitlers an. Im April 1945 wurde der Star von den sowjetischen Besatzungsbehörden festgenommen und nach Moskau gebracht, durfte jedoch zwei Monate später nach Deutschland zurückkehren. Später wurde bekannt, dass Tschechowa wahrscheinlich Agentin der sowjetischen Geheimdienste gewesen war. Pawel Suchoplatow, der Leiter der vierten Verwaltung des NKWD, der für diese Aktivitäten zuständig war, behauptete, ihre Aufgabe wäre unter anderem gewesen, bei der Vorbereitung eines Anschlags auf Hitler mitzuhelfen. Allerdings wurden ni
Der Mann hat meine Muschi unter der Dusche geschossen wie eine Frau, aber sie mag
Das russische Mädchen hatte Glück mit Champagner und ergab sich
Dunkelhaar Schlampe inmitten von zwei Muskelkerlen