Versuche sind super schwierig
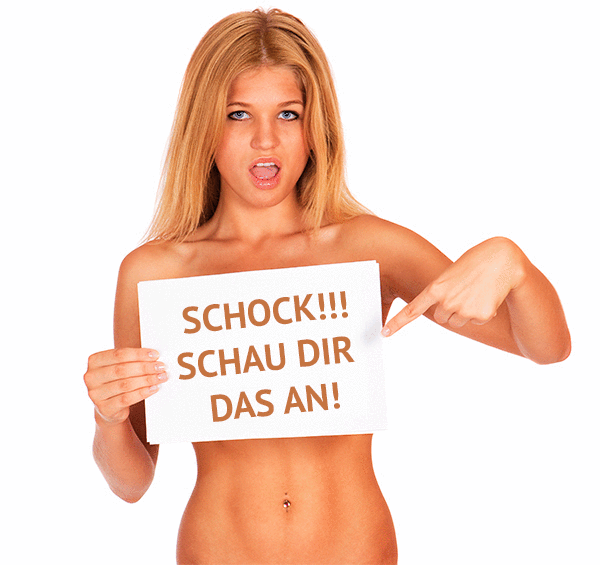
⚡ ALLE INFORMATIONEN KLICKEN HIER 👈🏻👈🏻👈🏻
Versuche sind super schwierig
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie auf Ihre Interessen abgestimmte Inhalte sowie unsere vielseitigen Newsletter.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie auf Ihre Interessen abgestimmte Inhalte sowie unsere vielseitigen Newsletter.
Jetzt Mitglied werden! Erleben Sie WELT so nah wie noch nie.
Home ICONIST Gesellschaft Warum nehmen wir auf die schwierigsten Menschen am meisten Rücksicht?!
Gesellschaft Ungerechtigkeit des Lebens Warum nehmen wir auf die schwierigsten Menschen am meisten Rücksicht?!
Veröffentlicht am 22.12.2017 | Lesedauer: 5 Minuten
Mariah Carey gilt ja als Diva. Ob die vielen Geschenke eine Besänftigungsmaßnahme ihrer Mitmenschen sind?
Sie sind einfach immer beleidigt. Und aus Angst, ihre Stimmung zu verderben, will man ihnen alles recht machen. So kommen schwierige Menschen stets ans Ziel. Ungerecht! Es gibt aber einen Ausweg.
Um die Problematik geht's in unserem Podcast
Warum es sinnlos ist, eine „coole Frau“ sein zu wollen
Zehn super Tipps für wirklich gelungenen Pärchenurlaub
Lasst mich rein, ich will doch nur feiern!
Wir Millennials sind verwöhnt, faul und unfähig. Alle!
Wann muss man mit Freunden „Schluss machen“?
So feministisch ist OnlyFans wirklich
Selenskyj will jeden „Kompromiss“ mit Moskau per Referendum absegnen lassen
Facebook und Instagram in Russland als „extremistisch“ verboten
So versuchen russische Influencer den Instagram-Bann zu umgehen
WIR IM NETZ Facebook Twitter Instagram UNSERE APPS WELT News WELT Edition
E s war einmal eine Großmutter , die sehr konkrete Vorstellungen davon hatte, wie sich die Familie ihr gegenüber zu verhalten hatte. „Als Großmutter möchte man eben hofiert werden“, pflegte sie zu sagen. Es gab ein paar Regeln, die dabei zu beachten waren. Man durfte ihr nur weiße Blumen schenken, alles andere fand sie ordinär. Ihre Mürbteigplätzchen mussten als die besten Mürbteigplätzchen anerkannt werden, die je ein Mensch auf Erden gebacken hatte. Sie verschenkte nie das, was sich jemand gewünscht hatte, sondern meist eine billigere Version davon; trotzdem musste man sich selbst für die Fake-Barbie überschwänglich bedanken, am besten schriftlich, damit es einen Beweis über die Danksagung gab. Denn andernfalls rief die Großmutter schluchzend ihren Sohn an, um die unzureichenden Dankesbekundungen im Speziellen und die schlechte Erziehung der Enkelkinder im Allgemeinen zu beklagen.
Die Großmutter hatte ein großes Talent, welches es ihr ermöglichte, die Geschicke ihrer Mitmenschen in eine ihr angenehme Richtung zu lenken: Sie konnte auf Knopfdruck weinen. Niemand konnte so ausdauernd beleidigt sein wie sie. Das zermürbte die Mitmenschen. Und sie taten lieber das, was der Großmutter gefiel. Der Sohn trug in ihrer Anwesenheit nur hellblaue Hemden und Krawatte. Die Enkel führten repräsentative kleine Konzerte für die “liebe Omi“ und deren Bridge-Freundinnen auf. Die Großmutter kam prächtig durchs Leben.
Ist es nicht eigenartig, dass sich im Leben so oft alles nach den Menschen richtet, die ganz besonders schwierig und anstrengend sind? Dass auf die Menschen, die am meisten Scherereien machen, immer so viel Rücksicht genommen wird?
Gerade vor Weihnachten sollte man darüber mal nachdenken. Durchschnittsfröhliche Menschen werden, im Gegensatz zu schwierigen Menschen, selten gefragt, ob ihnen die Pläne für die Feiertage genehm sind. Es wird erwartet, dass sie schon bei allem mitmachen und nicht auch noch Probleme produzieren werden. Dass sie in der Besprechung zur Urlaubsplanung der miesepetrigen Kollegin den Vortritt lassen, damit diese nicht noch miesepetriger wird. Dass sie für ein Treffen mit einer schnell überforderten Freundin den weiten Weg durch ganz Berlin auf sich nehmen, damit die Freundin das nicht machen muss. Dass sie die Menü-Planung für die Silvesterfeier schon ändern werden, wenn ein Gast Raclette partout nicht essen möchte, weil er angeblich „den Geruch von Käse“ nicht aushalten könne. Und nur Schweinefleisch isst, weil alles andere „zu doll nach Fleisch“ schmecke.
Im Grunde genommen haben es die Durchschnittsfröhlichen also viel schwerer als die Schwierigen. Von ihnen wird nicht nur verlangt, Rücksicht zu nehmen auf jedwede absurde Befindlichkeit – sie sollen sogar noch lernen, Verständnis dafür zu haben. Im Ratgeber „Der ganz normale Wahnsinn“ geben die beiden französischen Psychotherapeuten und Autoren François Lelord und Christophe André Tipps für den Umgang mit schwierigen Menschen: „Wenn Sie eine schwierige Persönlichkeit besser verstehen, wenn Sie sie akzeptieren, werden Sie ihr Verhalten besser voraussehen können und den Problemen, vor die er oder sie Sie stellt, erfolgreicher begegnen.“
Wie bitte? In der heutigen Zeit soll man auch wirklich für alles Verständnis aufbringen. Früher einmal war das ganz anders: Da dienten schwierige Charaktere als Grundausstattung für komödiantische Theaterstücke und Romane. Man denke nur an Molières „Eingebildeten Kranken“. Und in Jane Austens Romanen wird der Single-Heldin meist eine schräge Ehefrau gegenübergestellt, um die zurückhaltende, feinironische Vernunft der Single-Frau hervorzuheben. So was ist heute ja undenkbar.
Über schwierige Menschen darf man nicht mal mehr Späße machen; sonst schreien gleich besorgte Küchenpsychologen auf – „der ist halt so, den muss man so annehmen, wie er ist.“ Auch im Ratgeber Lelords und Andrés wird in jedem Kapitel streng davor gewarnt, sich über die anstrengenden Marotten schwieriger Zeitgenossen zu mokieren: „Machen Sie sich nicht lustig! Sehen Sie von ironischen Bemerkungen ab!“ Das sei das Allergefährlichste, was man einem schwierigen Menschen zumuten könne. Davon würde er nur noch schwieriger.
Moment mal. Aufschrei. Empörung. Das ist ja wohl man höchsten Maße ungerecht, dass man immerzu auf die größten Zicken und Eigenbrötler Rücksicht nehmen soll. Und diese damit durch- und zum Erfolg kommen.
Als halbwegs unkompliziert gelaunter Mensch bringt man es in diesem Leben zu nichts. Das muss man einfach mal einsehen. Die Schwierigen wird man nie bekehren können. Und wie viel Anerkennung die Anstrengung einbringt, Verständnis für jeden Egozentriker aufzubringen, na, das kann man sich ausrechnen. Gar keine.
Es scheint nur einen Ausweg zu geben: Schwierige Persönlichkeiten für alle! Legen Sie sich ruhig mal ein paar etwas anstrengendere Eigenschaften zu. Man kann, so steht es im Buch von François Lelord und Christophe André, aus insgesamt elf Modellen schwieriger Charaktere auswählen und diese gern untereinander kombinieren. Wie wäre es beispielsweise mit einer histrionisch-narzisstischen Persönlichkeit? Damit sind besonders theatralische Menschen mit ausgeprägtem Überlegenheitsgefühl gemeint, die gleichzeitig wahnsinnig empfindlich sind. Ein Traum für die Mitmenschen.
Zum Schluss noch ein Tipp. Wer jetzt sofort loslegt mit der Persönlichkeitsverwandlung, kann noch die Kontrolle über die Weihnachtsfeiertage erlangen. Lernen Sie von den Besten – zum Beispiel von Diva Mariah Carey. Egal, wohin Sie an Weihnachten reisen, fordern Sie stets ein Extrazimmer für Ihre zehn Hundewelpen sowie einen roten, von Kerzen umsäumten Teppich für Ihre Ankunft an! Lassen Sie sich hofieren. Sie werden sehen, die Menschen werden sich dieses Jahr einmal ganz nach Ihnen richten. Viel Spaß.
Frohe Weihnachten wünscht unsere Autorin - die auch auf juliahackober.com bloggt.
Folgen Sie uns unter dem Namen ICONISTbyicon auch bei Facebook , Instagram und Twitter
Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so sind Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de
Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/171778494
Gerade dachten wir noch, Corona verändert alles. Und jetzt? Der Psychoanalytiker Hans-Jürgen Wirth erklärt, warum wir die neue Realität nicht wahrhaben wollen - und empfiehlt der Gesellschaft eine Therapie.
Kommentare öffnen
Zur Merkliste hinzufügen
Link kopieren
Die Bindung an alte Gewohnheiten ist stark
Serviceangebote von SPIEGEL-Partnern
Speichern Sie Ihre Lieblingsartikel in der persönlichen Merkliste, um sie später zu lesen und einfach wiederzufinden.
Sie haben noch kein SPIEGEL-Konto?
Jetzt registrieren
Ein großartiges, heißes Sommerwochenende, und an der Ostsee ist der Strand von Scharbeutz überfüllt. So, dass er abgesperrt werden muss. Im Hamburger Schanzenviertel dürfen manche Kneipen und Kioske am Wochenende ab 18 Uhr keinen Alkohol verkaufen, um das massenhafte "Cornern" zu verhindern, das Herumstehen in Gruppen mit Bierflasche in der Hand. Der Hamburger Innensenator hat mit Freunden in einer Bar gefeiert. 200 Meter davon entfernt wird unverdrossen das größte Shoppingcenter Norddeutschlands gebaut. Die Lehrerinnen und Lehrer sind in den Urlaub gefahren, die Digitalisierung hat Ferien, vielleicht für immer, denn wer weiß, ob man nicht nach dem Sommer einfach wieder so unterrichten kann wie vor Corona.
Corona-Pandemie? War da was? Geht nicht alles letztendlich genauso weiter, nur manchmal muss man leider eine Maske tragen? Was ist aus den ganzen Ermutigungen und Aufbruchsstimmungs-Essays geworden, die dafür plädierten, jetzt wirklich grundsätzlich unseren Lebensstil zu überdenken, digitaler, nachhaltiger zu werden? Warum fällt es uns so schwer, unsere Lebensweise nachhaltig zu verändern? Warum rutschen wir in die alten Spurrillen zurück?
Hans-Jürgen Wirth, Jahrgang 1951, ist Psychoanalytiker, Paar- und Familientherapeut und Autor des Buchs »Narzissmus und Macht. Zur Psychoanalyse seelischer Störungen in der Politik«. Psychosozial-Verlag, Gießen.
Ideologie und Konventionen aufzugeben, löst Unsicherheit und damit Angst aus. Diese Angst vor dem Neuen bekommt man nicht allein mit rationalen Risikoabwägungen in den Griff. Denn die realitätsangemessenen Ängste werden häufig von irrationalen Befürchtungen überlagert und mit unbewussten Fantasien verwoben.
Ein Reaktionsmuster besteht darin, die Notwendigkeit von Veränderungen zu verleugnen und Sicherheit im Konventionalismus zu suchen. Wie die Leipziger Sozialforscher Oliver Decker und Elmar Brähler in ihren Autoritarismus-Studien gezeigt haben, sind autoritäre Einstellungen sehr häufig gekoppelt mit Konventionalismus. Autoritär eingestellte Personen plädieren häufiger dafür, "Traditionen unbedingt zu pflegen und aufrechtzuerhalten", sie vertreten häufiger den Standpunkt, "bewährte Verhaltensweisen sollten nicht infrage gestellt werden", und sie sind häufiger der Auffassung, "es ist immer das Beste, Dinge in der üblichen Art und Weise zu machen".
Im stark ausgeprägten Konventionalismus kommt der Wunsch zum Ausdruck, durch die Identifikation mit Tradition, Konvention und dem, was als normal und vertraut empfunden wird, ein Gefühl der Sicherheit und des Aufgehobenseins zu erlangen und die Angst vor Neuem, Unbekanntem, Fremdem in Schach halten.
Wer die Welt grundsätzlich als einen bedrohlichen Ort empfindet, weil er als Kind keine sicheren Bindungen erfahren hat und auch später zu sozialen Gruppen und gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen keine verlässlichen Beziehungen aufbauen konnte, wird das Gewohnte und das Althergebrachte idealisieren, weil die bedingungslose Identifikation mit der Tradition Sicherheit verspricht. Autoritär und konventionell eingestellte Personen widersetzen sich also aus Überzeugung gesellschaftlichen Neuerungen.
Die Krise stellt unser aller Leben auf den Kopf. Natürlich geht es erst einmal darum, gesund zu bleiben. Aber wie schaffen wir es, dass auch die Beziehung und die Familie intakt bleiben? Wie kommen wir heil durch den Alltag? Hier beantworten Experten regelmäßig Fragen zu diesen Themen. Hier finden Sie weitere Artikel aus der Reihe. Wenn Sie selbst eine Frage haben, schreiben Sie uns an: kollateralfragen@spiegel.de
Doch wie verhält es sich bei den Menschen, die die Dringlichkeit grundlegender Veränderungen kognitiv erkannt haben, sich aber dennoch der Veränderungen ihrer Lebensweisen hartnäckig widersetzen? Es gibt hier ganz erstaunliche Parallelen zu Menschen, die sich aufgrund einer persönlichen, privaten Krise in psychotherapeutische Behandlung begeben.
Im übertragenen Sinn befindet sich buchstäblich die ganze Welt momentan in einem Stadium der Krise, des Übergangs, der Neuorientierung. Ausgangspunkt der Coronakrise und der persönlichen Krise, die zur Psychotherapie führt, ist die Erfahrung von Krankheit, von körperlichem und seelischem Leid. In beiden Fällen geht es um einen Zustand der Hilflosigkeit, Ohnmacht und des Ausgeliefertseins an naturhaft ablaufende Prozesse. In beiden Fällen stellen sich als erste Reaktionen Gefühle von Angst und Hilflosigkeit ein und als Abwehrreaktionen Versuche der Verleugnung, der Bagatellisierung, der Relativierung. Erst wenn diese nicht mehr helfen und das Leiden und die objektive Gefahr nicht mehr abzustreiten sind, beginnt man, sich mit der Krankheit, ihren Ursachen, ihren Auswirkungen, ihrer Bedeutung und ihren möglichen Folgen für die nähere und weitere Zukunft ernsthaft auseinanderzusetzen.
Der dann einsetzende therapeutische beziehungsweise selbsttherapeutische Veränderungsprozess läuft aber auch nach dieser ersten Einsicht nicht reibungslos ab, sondern wird immer wieder unterbrochen durch Versuche, die Problematik zu verleugnen und für weniger relevant anzusehen. Illusionsbildungen wie beispielsweise die Überzeugung, die Probleme lösten sich schon irgendwie von selbst, gewinnen zwischendurch immer wieder die Oberhand. So könnte sich beispielsweise auch die Hoffnung auf einen hochwirksamen "Super-Impfstoff" noch als Illusion erweisen.
Im Unterschied zur Psychotherapie steht uns in der Coronakrise aber kein Therapeut zur Verfügung, der aufgrund seiner Rolle eine Metaposition einnehmen könnte. Die besondere Funktion der Therapeuten besteht nicht darin, mehr zu wissen oder besser zu wissen, wie die Patienten ihr Leben gestalten sollten, sondern darin, mithilfe der Distanz einen Selbstreflexionsprozess zu befördern.
Im aktuellen gesellschaftlichen Veränderungsprozess gibt es keinen Beobachter oder Kommentator, der eine solche Außenposition einnehmen könnte. Weder die Virologen noch die Politiker sind dazu in der Lage. Die Gesellschaft, also wir alle, müssen diese Funktion der Selbstreflexion schon selbst wahrnehmen. Insofern ist es wichtig, dass eine breite Diskussion stattfindet, die möglichst viele Individuen und gesellschaftliche Gruppierungen einbezieht, wie sich denn die Gesellschaft verändern könnte und in welche Richtung es dabei gehen sollte. Denn es besteht tatsächlich eine besondere Chance darin, dass so manches in unserem gegenwärtigen Leben nicht mehr so funktioniert und nicht mehr so abläuft wie früher.
Aus der Psychotherapieforschung wissen wir, dass man Veränderungen seiner Lebensweise kaum allein, sondern nur in einem engen Austausch mit anderen erfolgreich vollziehen kann. Man muss mit anderen kontinuierlich darüber sprechen, was man aus welchen Gründen und mit welchen Zielen in seinem Leben verändern will und welche Ängste, Zweifel und inneren Widerstände dabei auftreten.
Ein digitales Magazin zum Staunen, Schauen und Sich-fest-Lesen: Die Artikel im Ressort Leben widmen sich den großen und kleinen Fragen unserer Zeit rund um Gesundheit, Familie und Psychologie, Reise und Stil.
Für einen nachhaltigen Bewusstseins- und Verhaltenswandel ist es zudem notwendig, dass über kognitive Einsichten hinaus ein emotionaler Prozess initiiert wird, der alle Beteiligten mit ihrer gesamten Persönlichkeit erfasst. Auf die gesellschaftliche Ebene bezogen heißt das: Kollektive Probleme, beispielsweise der Klimawandel oder der Rassismus, müssen auch vom Einzelnen als ihn emotional betreffend, gar als erschütternd erlebt werden. Die "Fridays for Future"-Bewegung, aber auch die derzeitigen weltweiten Proteste gegen Rassismus haben gezeigt, dass eine soziale Protestbewegung eine enorme Dynamik auf der emotionalen Ebene der involvierten Aktivistinnen und Aktivisten, aber auch auf der politischen Ebene entfalten kann.
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Veränderungsbereitschaft ist die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. Wenn ich erfahre und am eigenen Leib erlebe, dass meine Bemühungen um Veränderung Wirkung erzielen, wird mein Selbstbewusstsein gestärkt. Ich gewinne den Mut und die Ausdauer, mich für das als richtig Erkannte einzusetzen und mich auch bei Rückschlägen nicht von meinem Weg abbringen zu lassen. So entsteht Selbstvertrauen in die eigene Änderungskompetenz.
Die Corona-Pandemie trifft, global gesehen, nicht alle Länder gleich, sondern mit ganz unterschiedlicher Wucht. Trotzdem eröffnet sie vielleicht die einmalige Gelegenheit, dass gleichsam die ganze Welt über dasselbe Problem spricht und Möglichkeiten diskutiert, wie man individuell und gesellschaftlich damit umgehen sollte. Es könnte der Moment für einen globalen Reifungsschritt sein.
SPIEGEL+-Zugang wird gerade auf einem anderen Gerät genutzt
SPIEGEL+ kann nur auf einem Gerät zur selben Zeit genutzt werden.
Klicken Sie auf den Button, spielen wir den Hinweis auf dem anderen Gerät aus und Sie können SPIEGEL+ weiter nutzen.
Melden Sie sich an und diskutieren Sie mit
Für nur 1 Euro erhalten Sie einen Monat Zugriff auf alle Artikel und jeden Freitag ab 13 Uhr
das digitale Magazin DER SPIEGEL.
Testen Sie Ihr Wissen!
13 harte Fragen – das superschwierige Erdkunde-Quiz
250 Euro Startguthaben mit der Platinum Card
Font size default 50% 75% 100% 150% 200% 300% 400%
Font family default monospaced serif proportional serif monospaced sans serif proportional serif casual cursive small capital
Font color default white black red green blue cyan yellow magenta
Font opacity default 100% 75% 50% 25%
Character edge default raised depressed uniform drop shadowed
Background color default white black red green blue cyan yellow magenta
Background opacity default 100% 75% 50% 25% 0%
Window color default white black red green blue cyan yellow magenta
Window opacity default 100% 75% 50% 25% 0%
There was no technology detected to playback the provided source
(SOURCE_NO_SUPPORTED_TECHNOLOGY)
Bitte sagen Sie uns, warum Sie diese Anzeige ausgeblendet haben
Bitte sagen Sie uns, warum Sie diese Anzeige ausgeblendet haben
Bitte sagen Sie uns, warum Sie diese Anzeige ausgeblendet haben
Bitte sagen Sie uns, warum Sie diese Anzeige ausgeblendet haben
Deine Datensicherheit bei der Nutzung der Teilen-Funktion
Um diesen Artikel oder andere Inhalte über Soziale-Netzwerke zu teilen, brauchen wir deine Zustimmung für diesen Zweck der Datenverarbeitung
Von TRAVELBOOK | 22. Januar 2021, 08:50 Uhr
Hier kommen 13 Geografie-Fragen, die es in sich haben. Da wird Erkunde-Wissen abgefragt, bei dem die meisten an ihre Grenzen stoßen. Apropos Grenzen ...
Besonders schwierige Fragen machen besonders viel Spaß – und das nicht nur uns, dem TRAVELBOOK-Team, sondern auch Ihnen, unseren lieben Lesern. Deshalb haben wir mal unsere Köpfe zusammengesteckt und wirklich kniffelige und schon fast gemeine Erdkunde-Quizfragen entwickelt.
Manchmal mag die Frage vielleicht einfach klingen, dann aber sind die es die Antwortmöglichkeiten, die es in sich haben. Meistens aber sind es einfach die Fragen, die schwierig sind. Wir jedenfalls hatten
Schüchterner Rotschopf bei POV-Fick
Student fickt Freundin mit einem dicken Schwanz mit Fett bei sich zu Hause
Brünette Mutti mit Rieseneutern gebumst