Sitzung mit Vietnamesem
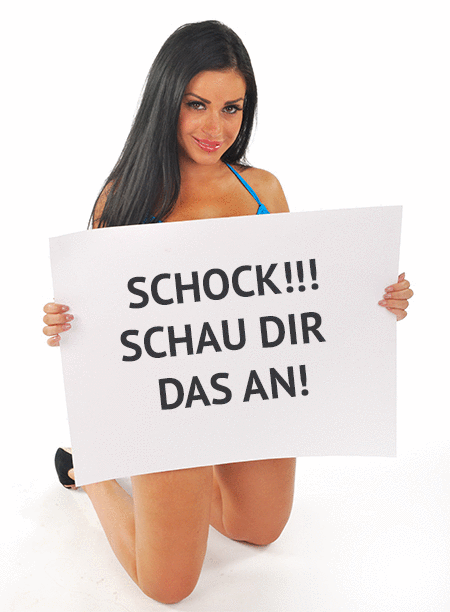
🛑 ALLE INFORMATIONEN KLICKEN HIER 👈🏻👈🏻👈🏻
Sitzung mit Vietnamesem
Ich bin mindestens 18 jahre alt Verlassen
Thanks for your attention. We will find out where this video was gone and bring it back.
Play Mute Fullscreen Fluid Player 3.0.4
Анонимный Сайт Знакомств в Moscow ?
FreeDirtyGame.com | FunFuckDolls.com | SexSimulators.com
german wife poppen por
edel teen sex porns
tina blond mollig porn
heisse teen aersche fo
you jizz mama deuche
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie diese Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. Ok ×
Die Seiten, die Sie besuchen wollen, können Inhalte enthalten, die nur für Erwachsene geeignet sind. Um fortzufahren, müssen Sie bestätigen, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind.
Embed:
Sitzung mit Vietnamesem angeboten durch MadchenSex.com
Sitzung Mit Vietnamesem kostenlos Porno video für Mobile & PC, geile Videos und pornos.
MadchenSex.com ist das Gratis Porno Tube für Mobile & PC Pornos. Schau dir tägliche geile Free Sex Filme aus den unterschiedlichsten Kategorien an. Egal ob du frei Porno videos von Voyeure, versaute Videos, geile amateurs, POV oder MILF sehen willst, hier auf unserer sex tube wird dir nichts vorenthalten. Täglich werden neue Großer runder Arsch videos veröffentlicht. Kostenlos Sexvideos sortiert in unzähligen Sextube kategorien. Wir bieten Gratis Pornos auch Mobile für dein Handy.
Quellen zur Geschichte der Menschenrechte
Sartres’ Eröffnungsrede zur ersten Sitzung des Vietnam-Tribunals (1967)
von Anna Pollmann
Jean-Paul Sartre kam bei der Zusammenkunft des Internationalen Tribunals gegen die Kriegsverbrechen in Vietnam (Russell-Tribunal oder Vietnam-Tribunal) in Stockholm vom 2. bis zum 10. Mai 1967 die Aufgabe zu, als Exekutivpräsident die erste Sitzungsperiode zu eröffnen. Das von Bertrand Russell initiierte Tribunal bestand aus linken, zumeist pro-kommunistischen Intellektuellen und Aktivisten, die sich zur Untersuchung und völkerrechtlichen Verurteilung des Vorgehens der Vereinigten Staaten in Vietnam zusammengefunden hatten. Es besaß weder ein völkerrechtliches Mandat noch bestand es aus juristisch oder politisch einflussreichen Personen. Sartre begründet dessen Legitimität aus der »doppelbödigen Wirklichkeit von Nürnberg«. Mit dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg 1945/1946 habe erstmals eine Strafgerichtsbarkeit mit universalem Anspruch seine Tätigkeit aufgenommen, diese jedoch gleich nach dem Ende der Prozesse wieder eingestellt. Das Russell-Tribunal knüpfte in Zeiten der Dekolonisierung und des Kalten Krieges an die »Präzedenz« von Nürnberg und das dort entwickelte menschenrechtlich inspirierte Völkerstrafrecht an. Auch wenn der Menschenrechtsbegriff selbst für die politische Zielsetzung und Rhetorik des Tribunals nicht zentral war, wurde dieser über den Bezug auf (antikoloniale) Selbstbestimmung und die Forderung nach universalen Prinzipien evoziert.
Anhand des Vietnam-Tribunals lässt sich zudem eine »transformative Phase gesellschaftlichen Aktivismusʼ« der nun transnational vernetzten Neuen Linken nachvollziehen, die sich in ihrem Protest gegen Kolonialismus und den Nord-Süd-Konflikt verstärkt auf vernachlässigte Kategorien des humanitären Völkerrechts bezog. In der Wahrnehmung und Verurteilung der amerikanischen Kriegsverbrechen in Vietnam zeigte sich zeitlich verschoben eine Verquickung von Deutungsmustern des Zweiten Weltkrieges mit denen des Kolonialismus, vor allem in der Kategorisierung von Massengewalt als Genozid.
AutorIn Dr. des. Anna Pollmann ist Minerva Post Doc Stipendiatin am Department for Modern History an der Hebrew University of Jerusalem.
Das Vietnam-Tribunal wurde von dem britischen Philosophen, Mathematiker und Friedensaktivisten Bertrand Russell initiiert und durch die Bertrand Russell Peace Foundation (BRPF) finanziell gefördert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war Russell bereits mit seinem Engagement für die Campaign for Nuclear Disarmamament in Erscheinung getreten, aus der auch Kontakte zu späteren Mitgliedern des Tribunals herrührten. Seine Stiftung förderte Friedensinitiativen und den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit und für Menschenrechte. In der Polarisierung des Kalten Krieges hatte Russell stets eindeutig gegen die Vereinigten Staaten Stellung bezogen. Das Vorgehen in Vietnam hatte er bereits 1963 wiederholt kritisiert – zu einem Zeitpunkt also, als dies noch eine Minderheitenposition war. [1]
Nachdem die Vereinigten Staaten seit Februar 1965 mit der Luftoffensive Rolling Thunder aktiv in den nach-kolonialen Bürgerkrieg im seit 1954 geteilten Vietnam eingetreten waren, dränte er schließlich mit dem Tribunal auf eine politische Intervention. Bis dahin hatten die Vereinigten Staaten das Dien-Regime im Süden mit Militärberatern gegen die Kommunisten und die Nationale Front für die Befreiung Südvietnams (engl. National Liberation Front, abgekürzt NLF) unterstützt. Nach Monaten der graduellen Eskalation schien Präsident Lyndon B. Johnson und seinen Beratern eine Entsendung von Bodentruppen als einziger Ausweg, eine Aufgabe Südvietnams zu verhindern und Glaubwürdigkeit in der bipolaren Ordnung des Kalten Krieges bewahren zu können. [2] Als das Tribunal zusammentrat, waren in diesem »Krieg ohne Fronten« [3] durch Bombenangriffe, den Einsatz neuester Rüstungstechnik, Napalm und Splitterbomben bereits viele Tausende Zivilisten getötet und Ortschaften dem Erdboden gleichgemacht worden. Zwar hatten mit den Reportagen Harrison E. Salisburys in der New York Times die Bilder der Zerstörung bereits 1966 die amerikanische Öffentlichkeit erreicht, eine breite Opposition gegen den Krieg bildete sich jedoch erst allmählich heraus. [4] Die nach der Luftoffensive 1965 beginnenden zumeist universitären Proteste und auch Salisbury wurden der Parteiname für den kommunistischen Norden bezichtigt. Erst 1967 und vermehrt durch die Berichterstattung während der Tet-Offensive zeigte sich eine zunehmende Unzufriedenheit mit der verlustreichen amerikanischen Kriegsführung. Der Truppenabzug und das mögliche Ende des Krieges wurden schließlich zu einem zentralen Thema der Wahlkampagne 1968. [5] Unter diesen Umständen gelang es dem Russell-Tribunal mit seiner vergleichsweise frühen und medial präsenten Intervention auch, eine Gegenöffentlichkeit zur hegemonialen Kriegsberichterstattung herzustellen. Es konnte amerikanische Aktivisten wie den Pazifisten Dave Dellinger und Carl Oglesby, Präsident der amerikanischen Students für Democratic Society, für die Initiative gewinnen. Der Schulterschluss mit den amerikanischen Protesten gelang jedoch nur teilweise. Die Vietnamkritik in den USA war vor allem mit innenpolitischen Themen wie Armutsbekämpfung, der Diskriminierung von Afroamerikanern, Gesundheits- und Bildungspolitik verknüpft. Die Genozidthematik, mit der im Tribunal eine Analogie zu nationalsozialistischen Verbrechen hergestellt wurde, spielte hier kaum eine Rolle.
Politisch stand das Russell-Tribunal in der Tradition der Bürgertribunale der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In den Jahren 1933/1934 hatte Willi Münzenberg in Paris und London Gegen-Tribunale zum Leipziger Reichstagsbrandprozess initiiert. Auf die Moskauer Schauprozesse hatte Leo Trotzki 1937/1938 mit der Organisation eines Tribunals in New York und Mexiko reagiert. [6] Waren diese beiden historischen Vorläufer jedoch in der konfliktreichen Geschichte des Kommunismus zu verorten, so wurde im drei Jahrzehnte später stattfindenden Russell Tribunal ein sich ändernder politischer Orientierungsrahmen innerhalb der Linken sichtbar. Russell hatte eine internationale Gruppe von Schriftstellern, Philosophen und Juristen eingeladen, die sich durch ihren intellektuellen und moralischen Beitrag »zu dem, was man nach einer optimistischen Mode ›menschliche Zivilisation‹ nennt«, auszeichneten. [7] Personell waren hier sowohl alte Kommunisten, Dissidenten wie Trotzkisten, als auch intellektuelle Ikonen der Neuen Linken anwesend. Mit Jean-Paul Sartre als Exekutivpräsidenten stand dem Tribunal einer der einflussreichsten europäischen Intellektuellen der Nachkriegszeit vor. In seiner in Tokio und Kyoto gehaltenen Vorlesung Plädoyer für die Intellektuellen von 1965 hatte er es als deren Pflicht benannt, den geistigen Bereich zu verlassen, praktisch zu werden, ihre Stimme und ihr symbolisches Kapital den Unterdrückten zu leihen und hatte dabei auf die Situation in Vietnam Bezug genommen. [8] Die von ihm herausgegebene, einflussreiche Zeitschrift Les Temps Modernes hatte seit ihrer Gründung 1945 Stellung gegen die französische Kolonialherrschaft in Indochina und Algerien bezogen. Hier wurde erstmals die Deutung des Zweiten Weltkrieges und des französischen Kolonialkrieges verknüpft und eine Analogie zwischen Résistance und vietnamesischer Guerilla hergestellt. [9]
Neben Sartre war eine verhältnismäßig große Gruppe französischer Aktivisten und Juristen in Stockholm präsent – und damit zugleich auch die erinnerungs- und kolonialpolitischen Konfliktlinien der Nachkriegsrepublik. Die Philosophin Simone de Beauvoir, der Filmemacher Claude Lanzmann und Leon Matarasso, der Präsident der juristischen Kommission und zuvor Ankläger in Nürnberg, hatten dem Pariser Résistance-Milieu angehört. Die tunesisch-französische Anwältin Gisèle Halimi hatte während ihrer Tätigkeit im FLN-Anwaltskollektiv die Kämpferinnen und Folteropfer Djamila Bouhired und Djamila Boupacha verteidigt und in diesem Kontext bereits 1961 ein Nuremberg pour l’Algérie gefordert. Dieser radikale antikoloniale Menschenrechtsaktivismus richtete sich unter Berufung auf den vermeintlichen Universalismus der Nürnberger Prinzipien gegen die etablierte französische Linke und ehemalige résistants in der Regierung und wandte deren Résistance-Mythos gegen sie selbst. Dies war eine Argumentationslinie, die im Russell-Tribunal weiterverfolgt werden sollte. [10]
Zu den Geschworenen gehörten weiterhin der Schriftsteller und Philosoph Günther Anders, der italienische sozialistische Jurist Lelio Basso und der jugoslawische Historiker Vladimir Dedijer. Mit Stokely Carmichael und James Baldwin waren prominente Figuren der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung eingeladen, zudem kamen der pakistanische Politiker und Richter Mahmud Ali Kasuri und der philippinische Dichter Amando Hernandez. Russell selbst hatte aufgrund seines hohen Alters die Geschäfte seinem im Tribunal jedoch umstrittenen trotzkistischen Privatsekretär Ralph Schoenman übertragen, der auch als einer von mehreren Kriegsberichterstattern nach Vietnam reiste. Dem Tribunal gehörten keine Teilnehmer aus Vietnam an, die NLF sandte jedoch Delegierte. Zudem wurden vietnamesische Opfer – Guerillakämpfer wie Zivilisten – als Zeugen nach Europa gebracht, um ihre Aussagen vorzutragen.
Von Beginn an bestanden Spannungen zwischen dem Londoner Büro der BRPF unter der Leitung von Schoenman und einer starken Pariser Sektion, die durchsetzte, das Sekretariat in die französische Hauptstadt zu verlegen. Hier kam auch ein (erinnerungs-)politischer Konflikt zum Ausdruck. Während die Londoner die Unterstützung des revolutionären, antiimperialisitischen Kampfes in der »Dritten Welt« in den Mittelpunkt stellten, warfen sie der Gruppe um Sartre eine legalistische Perspektive vor. Diese betone zu stark die Anwendung jener völkerrechtlichen Prinzipien, von denen die Nachkriegsprozesse getragen gewesen seien. Oglesby pointierte diesen Konflikt in der Bemerkung, es sei nicht Auschwitz, sondern Guernica, das im Russell Tribunal erneut zur Verhandlung stünde. [11]
In der Eröffnungsansprache wie auch in den auf das Tribunal folgenden Publikationen sollte jedoch der französische Standpunkt überwiegen. Die exponierten juristischen Bezugspunkte waren die Nürnberger Charta (auch Londoner Statut) und die darin formulierten neuartigen Kategorien Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zum einen war mit Nürnberg das Prinzip der Verantwortung des Einzelnen für staatliche Verbrechen angewandt worden. Erstmalig erlaubte dies die konsequente Verfolgung staatlich legitimierter Verbrechen durch ein international zusammengesetztes Gericht. Zum anderen war die Definition von Kriegsverbrechen erweitert worden. Mit dem Anklagepunkt Verbrechen gegen die Menschlichkeit lag ein völkerrechtliches Novum vor, mit dem Handlungen definiert worden waren, die sich gegen die Zivilbevölkerung eines Landes richteten, ohne in direktem Zusammenhang mit Kriegshandlungen zu stehen. Darunter fielen die Ermordung, Versklavung und Deportierung von Zivilisten sowie Verfolgungen aus politischen, rassistischen oder religiösen Gründen. [12] Der jüdisch-polnische Jurist Raphael Lemkin hatte erfolglos versucht, die von ihm bereits in den dreißiger Jahren ausgearbeitete juristische Kategorie des Genozids in die Nürnberger Rechtsprechung einzubringen. Dieser wurde zwei Jahre später 1948 durch die UN-Genozid-Konvention in den Menschenrechtsabkommen verankert. [13] Als Genozid definiert Artikel 2 der Konvention, »Handlungen, die in der Absicht begangen [werden,] eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören«.
Im Jahr der konstituierenden Sitzung des Russell-Tribunals 1966 war des Weiteren rhetorisch und juristisch ein Zusammenhang von Dekolonisierung und Menschenrechten hergestellt worden. Das »Recht auf Selbstbestimmung der Völker« wurde in zwei Menschenrechtspakten – dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie dem Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte – aufgenommen. Dieses Recht war im Prozess der Dekolonisierung zu einem zentralen, aber nicht unumstrittenen Gegenstand der Verhandlungen geworden. Bei der Konferenz von Bandung von 1955 hatten zahlreiche asiatische und afrikanische Staaten die Selbstbestimmung der Völker zur Voraussetzung für die Erlangung individueller Menschenrechte erklärt. [14] Diese Verknüpfung war jedoch nicht unumstritten. Kritiker argumentierten auch mit Blick auf die nationalsozialistische Annexionspolitik, dass mit der Einforderung von Gruppenrechten individuelle Rechte unterlaufen werden könnten. [15] Auch wenn im Befreiungsdiskurs ein Bogen zu den Menschenrechten geschlagen wurde, wurde der Begriff nicht als eigenständige positive Bezugsgröße verwendet, sondern war im antikolonialen Gebrauch an eine Reihe von ökonomischen und politischen, teils nationalistischen Zielvorstellungen gekoppelt. [16]
In seiner Eröffnungsrede bezeichnete Sartre es als Pflicht der ersten Sitzung des Tribunals, »seine Entstehung, seine Funktion, seine Ziele und Beschränkungen« darzustellen. Zentrales Anliegen war es dabei, die Frage der Legitimität zu klären, die in der amerikanischen und europäischen Öffentlichkeit in Zweifel gezogen wurde. Besonders stark wogen hier die Vorwürfe der politischen Einseitigkeit, der kommunistischen Beeinflussung und des Antiamerikanismus. [17] Sartre selbst leitete diese Legitimität historisch her und bezog sich dabei auf das Völkerrecht, insbesondere auf den Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg, der dem Tribunal als Vorbild diene. Mit dessen Zusammentreten 1945 sei ein »absolut neues Ereignis« in die Geschichte getreten, nämlich die Möglichkeit, eine kriegführende Macht für ihre Verbrechen zu verurteilen und damit »in einer universellen Weise« die Zukunft für eine supranationale Rechtsprechung zu öffnen. Er beschrieb Nürnberg als »Embryo einer Tradition«, mit dem »Permanenz und Universalität bestätigt und unabänderliche Rechte und Pflichten definiert« worden seien. Die Nürnberger Prinzipien waren im Juni 1945 in der Charta der Vereinten Nationen verankert worden, ohne die permanente Etablierung einer internationalen Gerichtsbarkeit sei jedoch eine »Lücke zurückgelassen« worden, für deren Schließung das Vietnam-Tribunal Verantwortung trage. Während für die Nürnberger Prozesse die Schaffung neuer juristischer Kategorien zentral gewesen war, vermischte sich im Vietnam-Tribunal der Bezug auf Rechtskategorien mit der Rhetorik des Antikolonialismus und des Kalten Krieges und dem Wunsch nach der Ausbildung einer politischen Moral.
An den Nürnberger Prinzipien zeigt Sartre schließlich einen Widerspruch im universalistischen Anspruch der Alliierten auf, »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« zu verurteilen. Während hochrangige Vertreter des nationalsozialistischen Regimes auf der Anklagebank gesessen hätten, seien die Ankläger in den Kolonien in völkerrechtlich zu verurteilende, genozidale Praktiken verstrickt gewesen. Bereits die mangelnde Durchsetzung der internationalen kriegsrechtlichen Verträge der Zwischenkriegszeit, wie der Briand-Kellog-Pakt von 1928, sei darauf zurückzuführen, dass die unterzeichnenden Staaten ihr Vorgehen in den Kolonien nicht sanktionieren lassen wollten. Mit dem Ende der Prozesse in Nürnberg sei die »Idee der Universalität« erneut »vernachlässigt« worden. Am Tag der deutschen Kapitulation etwa sei es im algerischen Sétif bei einem Gedenkmarsch zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und französischen Truppen gekommen. Erstere hätten die algerische Nationalflagge gezeigt und somit den Jubel über das Kriegsende mit der Forderung nach Gleichheit und einem Ende des Kolonialregimes verbunden. In den folgenden Wochen seien an die Tausend Algerier getötet worden. Im zweiten Jahr der Nürnberger Prozesse, 1946, habe Frankreich im Ersten Indochina-Krieg gegen die vietnamesische Liga für die Unabhängigkeit gekämpft , jedoch 1954 eine Niederlage erlitten.
Auf die rhetorische Frage, ob seit 1945 weder Kriegsverbrechen, Aggressionskriege noch Praktiken des Völkermordes verübt worden seien, antwortete Sartre mit dem Verweis auf den konflikthaften Prozess der Dekolonisierung und den »Kampf der Dritten Welt um die Befreiung«. Ein direkter Verweis auf das bereits in der UN-Charta verbriefte Recht auf Selbstbestimmung der Völker fehlte in Sartres Eröffnungsrede, er bezog sich jedoch sehr positiv auf »Befreiung« als politischen Prozess. Es ist diese Bezugnahme auf zwei unterschiedliche historische Rahmen des Menschenrechtsdiskurses – Nürnberg und das revolutionstheoretisch aufgeladene Selbstbestimmungsrecht – die die spezifische Semantik des Tribunals ausmachten. Aber auch an anderer Stelle wich Sartre von einer strikt legalistischen Argumentation ab und bezog eine antiimperialistische Perspektive mit ein.
Sartre verwandte einen wenig spezifizierten Völkermord-Begriff und trat für eine Verurteilung der Vereinigten Staaten ein. Dieser Anklagepunkt war jedoch unter den Teilnehmern umstritten. [18] In der Sitzung von Roskilde nahm er in einem langen Vortrag zum Begriff des Völkermordes zwar Bezug auf die ursprünglich juristische Definition Lemkins, erweiterte diese jedoch in nicht unerheblichem Maße, womit nicht nur der Begriff unbestimmt blieb, sondern auch von der rechtlichen auf die politische Ebene übertragen wurde. Die Ursache für genozidale Tendenzen im Allgemeinen wie für den Holocaust im Besonderen machte Sartre in der Kulmination des kapitalistischen Wertschöpfungsprozesses aus, der auf eine totale Kriegsführung angewiesen sei. [19] Zu ergänzen ist die von ihm nicht erwähnte Tatsache, dass die Vereinigten Staaten 1967 die UN-Genozid-Konvention noch nicht ratifiziert hatten. Auf die spezifische Kriegskonstellation in Vietnam und die dort begangenen Kriegsverbrechen geht er nicht ein. Ihre Verurteilung steht hier stellvertretend für eine Reihe völkerrechtlich ungeahndeter Kriegsverbrec
Milf Aus Hannover Durchgenagelt - Amateurin Von Hinten Gefickt - Pornhub Deutsch
Junge Schwangere Fotzen Beim Riskanten Offentlichen Amateur Swinger Gangbang - Pornhub Deutsch
Mutter Und Teen In Der Badewanne Was Fur Eine Geile Alte Tittenstute - Pornhub Deutsch