Schöne Masseuse, die sanft ein Mitglied eines Sängers einer Rockband fingert und s
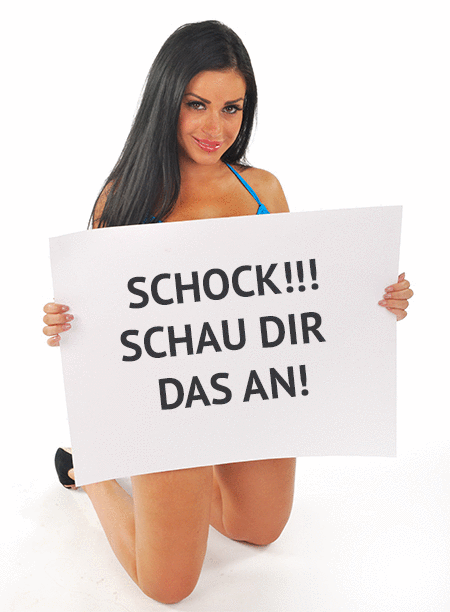
🔞 ALLE INFORMATIONEN KLICKEN HIER👈🏻👈🏻👈🏻
Schöne Masseuse, die sanft ein Mitglied eines Sängers einer Rockband fingert und s
taz. die tageszeitung vom 25. 9. 1996
Alle Rechte vorbehalten. Für Fragen zu Rechten oder Genehmigungen wenden Sie sich bitte an lizenzen@taz.de zur mobilen Ansicht wechseln
■ Zensur durch Mord: Der algerische Rai-Sänger Cheb Aziz war kein Politbarde. Er besang die Liebe und den Alltag – und genau deshalb wurde er ermordet
„Ya Rai“ – „Ich sage meine Meinung“ –, Konfession am Versende der Musik sogenannter „Chebs“ (Jungen) und „Chebas“ (Mädchen), gab einer ganzen Stilrichtung ihren Namen: der in der algerischen Stadt Oran entstandenen Rai-Musik. Doch für ihre Vertreter ist es schon seit langem lebensgefährlich geworden, ihre Botschaft zu verbreiten. Nach Cheb Hasni, dem prominentesten Opfer der islamischen Fundamentalisten, der im September 1994 auf offener Straße exekutiert wurde, ist nun Cheb Aziz im Osten des Landes ermordet aufgefunden worden. Das teilten die Sicherheitsdienste am vergangenen Freitag mit.
Der 28jährige Sänger, der mit bürgerlichem Namen Bechiri Boudjema hieß, war in der Nacht zum Freitag von mutmaßlichen Fundamentalisten entführt worden. Er hatte im Stadtteil Emir Abdelkader an einer Hochzeit teilgenommen, zu der er eigens aus seinem Londoner Exil angereist war. Fast alle prominenten Rai-Sänger, darunter Cheba Zahouinia, Cheb Mami und auch Cheb Khaled, der erste Superstar des Genres, leben aus Angst vor Mordanschlägen im europäischen Ausland, größtenteils in Paris.
Cheb Aziz war selbst in Algerien kein ausgesprochener Star, weder „Prince“ noch „King“ des Rai, eher eine Lokalgröße. Bekannt war er vor allem im Nordosten des Landes, wo mehrere Kassetten, Algeriens gängige Verbreitungsform populärer Musik, mit seinen Aufnahmen kursierten. Das algerische Fernsehen sendete am Samstag ein Video, das er kurz zuvor aufgenommen hatte.
Aziz' Lieder waren, wie die der meisten Rai-Interpreten, unpolitisch, handelten von Liebe und Alltag – und genau das ist der Islamischen Heilsfront (FIS) ein Dorn im Auge. 75 Prozent der Algerier sind unter 30, vor allem aus ihnen hat die FIS vor den Wahlen von 1991 ihre Anhänger rekrutiert: den Verlierern einer gescheiterten Bildungsreform und einer überstürzten Arabisierungspolitik, denen selbst der Schulabschluß nur den Zugang zu Arbeitslosigkeit und Langeweile eröffnet. „Mir bedeutet nichts etwas außer Alkohol und Musik“, heißt eine Liedzeile von Cheb Hindi, einem der wenigen Rai-Sänger, die noch nicht nach Europa geflohen sind, sondern unter schwierigen Bedingungen weiterproduzieren.
Die Zensur qua Mord ist nur der extreme Ausdruck der Verfolgung des „nordafrikanischen Rock 'n' Roll“ und seiner Protagonisten. Wegen seiner „anrüchigen“ Texte war der Rai, der seinen Siegeszug in der algerischen Jugend in den Achtzigern antrat, schon unter dem Regime der damaligen Einheitspartei FLN in Algerien zunächst verboten. Ein Zensor wachte streng darüber, was in Radio und Fernsehen gesendet werden durfte. Auch acht Jahre nach dem Ende des Einparteiensystems wird immer noch kontrolliert, welche Rai-Titel im Radio laufen dürfen. Armin Engel
Wollen Sie taz-Texte im Netz veröffentlichen oder nachdrucken? Wenden Sie sich bitte an die Abteilung Syndikation: lizenzen@taz.de .
Sign In
Register
English
English
Spanish
German
French
Russian
Home
Haarige Kunst: Über den Eigensinn des Haars und das Können von Friseuren [1. Aufl.]
9783658290863, 9783658290870
Table of contents : Front Matter ....Pages I-VIII Wer kennt es nicht? – Eine Einführung (Hans G. Bauer, Fritz Böhle)....Pages 3-14 Was alles am Haar hängt – ein kulturhistorischer Streifzug (Hans G. Bauer, Fritz Böhle)....Pages 17-82 Zur Lage des Friseurs – Soziodemographisches (Hans G. Bauer, Fritz Böhle)....Pages 85-100 Unsichtbares Handeln – die (Un-)Möglichkeit, ein guter Friseur zu sein (Hans G. Bauer, Fritz Böhle)....Pages 103-142 Epilog (Hans G. Bauer, Fritz Böhle)....Pages 145-148 Back Matter ....Pages 149-175
Roy
info@ebin.pub
Tiptrans, Ste #29578, 2E Parkinson Road, Liverpool, Merseyside, L9 1DL, UK
Copyright © 2022 EBIN.PUB. All rights reserved.
Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data . Agree Cookies
German
Pages VIII, 174
[172]
Year 2020
Das vorliegende praxisorientierte Buch erörtert die Grundlagen der Theaterdisposition mit Blick auf die für diese Tätigk
Jeden Tag erreichen uns Bilder, Fotos und Videos über Konflikte und Krisen, die unsere Vorstellung und unser (vermeintli
Das Eigene und das Fremde stellt ein in der Mediävistik zuletzt häufiger, allerdings auch höchst divergent behandeltes T
This study investigates the reception of contemporary religion in Hellenistic poetry. Using the cult of Artemis as a par
Jennifer Lung entwickelte ein Testinstrument, mithilfe dessen sie das Schulcurriculare Fachwissen von 703 Mathematiklehr
Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen war in den letzten Jahren in Deutschland rückläufig. Corona-Krise und strukturelle
Christoph Schneider untersucht Erlebnisse von Resorturlaubern. Das Ziel seiner Forschung ist es, zu verstehen, wie und i
1. Auflage, Oldenbourg Schulbuchverlag, Mnchen, 2016. 448 S. mit zahlreichen Abb., Pappband - neuwertig -
Hans G. Bauer Fritz Böhle Haarige Kunst Über den Eigensinn des Haars und das Können von Friseuren Haarige Kunst Hans G. Bauer · Fritz Böhle Haarige Kunst Über den Eigensinn des Haars und das Können von Friseuren Hans G. Bauer München, Deutschland Fritz Böhle München, Deutschland ISBN 978-3-658-29086-3 ISBN 978-3-658-29087-0 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-658-29087-0 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informa tionen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral. Umschlagbild: Der Gott der Friseure von Otto Dix © VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bereitstellung der Daten: Buchheim Museum, Bernried Verantwortlich im Verlag: Cori A. Mackrodt Springer ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH und ist ein Teil von Springer Nature. Die Anschrift der Gesellschaft ist: Abraham-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden, Germany I n h a lt I Wer kennt es nicht? – Eine Einführung 1 Alltagsspiegel 2 Kulturspiegel 3 Wissenschaftsspiegel 4 Berufs-, Handwerksspiegel 5 Inhaltsspiegel 3 5 6 7 10 12 II Was alles am Haar hängt – ein kulturhistorischer Streifzug 1 Sprache – was sie über das Haar verrät 2 Rituale – mit dem und um das Haar 3 Haare und Friseure – die alten Kulturen 4 Die (europäischen) Mittelalter bis zur Frühen Neuzeit 5 Das Jahrhundert des Bürgers 6 Im Dschungel der Moderne 17 19 26 31 36 54 68 III Zur Lage des Friseurs – Soziodemographisches 1 Bedeutung und Charakteristika der Branche 2 Betriebstypen 3 Entwicklung der Betriebsstätten 4 Entwicklung von Angebot und Nachfrage 5 Arbeitsbedingungen, Arbeitsbelastungen 85 86 88 90 93 98 V VI Inhalt IV Unsichtbares Handeln – die (Un-)Möglichkeit, ein guter Friseur zu sein 1 Der Friseur als Beruf 2 Das Geschehen im Friseursalon 3 Das Besondere der Dienstleistungsarbeit 4 Kooperation mit Kunden – Das Wunder der Verständigung 5 Gefühlsmanagement – Eigene Gefühle und die Gefühle Anderer 6 Die Arbeit mit dem Haar – Eigensinn und Lebendigkeit 103 103 106 117 121 126 133 Epilog 145 Literaturverzeichnis 149 Internetseiten 155 Anhang 159 Tabellen 159 Abbildungen 159 Bildnachweise 160 Anmerkungen 165 Anmerkung zur gendergerechten Begrifflichkeit Oft wird mit dem Argument der Leserfreundlichkeit des Textes die Variante bemüht, man behalte zwar die maskuline Sprachform bei, Frauen und Transgender seien aber selbstverständlich mitgemeint. Uns ist bei der Bearbeitung dieses Themas immer wieder die Frage begegnet: Soll man sich aus Gründen gendermäßig-politischer Korrektheit wirklich die Haare raufen, wenn das Haar, um das es ja eigentlich geht, im Deutschen sowieso ein Neutrum ist? Hinzu kommt: Über lange Zeit war das Haar fest in Männerhand. Erst in der jüngeren Vergangenheit wurde er zu einem ›typischen‹ und dominant von Frauen ausgeführten Beruf. Der Ruf nach der »Friseuse« ist bereits seit einer ganzen Weile ähnlich diffamierend wie der nach dem verniedlichenden, bedienenden und unverheirateten ›Fräulein‹. Und für die Unterstellung eines in diesem Beruf vorfindbaren besonders hohen Anteils Homosexueller finden sich keine statistischen Belege. Gerne hätten wir uns auf die Position des liebevoll-genauen Alltagsbetrachters, Kabarettisten und Philosophen Karl Valentin zurückgezogen, dass viele Friseure wie Kunden an vielen Tagen nicht so recht wüssten, ob sie heut’ ein ›Manderl‹ oder ein ›Weiberl‹ seien, und man sie daher getrost als ›Friseure‹ ansprechen könne. Wir haben uns daher entschlossen, diese Bezeichnung überall dort beizubehalten, wo in erster Linie der Beruf des Friseurs gemeint ist. Auch Kunden bleiben Kunden (selbst wenn sie mehrheitlich Kundinnen sind). Die in den Literaturzitaten genutzten Begrifflichkeiten bleiben unverändert. Ansonsten aber sprechen wir von ›Friseurinnen‹ – insbesondere dann, wenn sie selbst zu Wort kommen. Die männlichen und anderen Kollegen sind selbstverständlich immer mitgemeint. VII Im Dickicht der Haare I W e r k e n n t e s n i c h t ? – Ei n e Ei n f ü h r u n g Niemand entflieht der tagtäglichen Erfahrung mit seinem Haar. Kaum jemand kommt ohne ein dramatisches, wenn nicht traumatisches Friseurerlebnis durchs Leben. Mit dem Haar verbinden sich intensive persönliche Erlebnisse und Erfahrungen. Sie berühren uns und gehen unter die Haut. Wovon hängt es ab, dass wir nicht verstört, sondern möglichst zufrieden in den Spiegel des Friseursalons blicken? Damit befasst sich dieses Buch. Man könnte natürlich auch ein Markt- und Meinungsforschungsinstitut mit einer Kundenbefragung beauftragen. Aber wir als Kundin und Kunde wissen: Wir können zwar meist recht gut beschreiben, ob und wie zufrieden wir mit dem Ergebnis sind. Weit schwieriger ist jedoch die Beurteilung, wie dieses zu Wege gebracht wurde. Wir richten daher die Aufmerksamkeit auf das ›Gegenüber‹: die Friseurinnen und Friseure sowie auf das Haar. Sie erscheinen uns als gewohnt und bekannt – aber vielleicht hat es gerade mit dieser Selbstverständlichkeit des Bekannten zu tun, dass uns vieles von dem verborgen bleibt, was dort stattfindet. Wir laden Sie daher ein zu einem Blick hinter das Gewohnte, zu einer Betrachtung der Kulturgeschichte des Haares und der nicht unmittelbar sichtbaren Seiten der Friseurarbeit. Es gibt vieles zu entdecken: In unserer Alltagssprache taucht das Haar in vielfältigen Redewendungen und Bedeutungen auf. Wir alle kennen ›das Haar in der Suppe‹ oder die ›Haarspalterei‹. Das Haar spielt seit jeher in Mythen und Ritualen der gesamten Menschheitsgeschichte eine gewichtige Rolle. Es ist ein Teil des menschlichen Körpers und bringt das Verhältnis des Menschen zu seinem Körper zum Vorschein: wie er ihn pflegt, zur Schau stellt, ausgrenzt oder diszipliniert. Wir begegnen hier unserer eigenen Natur und sehen sie als eine höchst persönliche und individuelle Angelegenheit. Doch das, was uns so © Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020 H. G. Bauer und F. Böhle, Haarige Kunst, https://doi.org/10.1007/978-3-658-29087-0_1 3 4 Wer kennt es nicht? – Eine Einführung naturhaft, persönlich und individuell erscheint, ist zugleich eng verwoben mit sozialen und kulturellen Wertungen, Normen, Erwartungen und Verhaltensformen. So kommt dem Umgang mit dem Haar in der Kultur- und Gesellschaftsentwicklung eine sehr wechselvolle Geschichte zu, die bis heute andauert. Am Haar hing und hängt vieles – das ist nicht nur eine Redensart. Auch die soziale Stellung derjenigen, die sich beruflich mit dem Haar befassen, wird dadurch geprägt, welche Rolle das Haar und der Körper in der Gesellschaft spielen. Dies findet seinen Ausdruck in Anerkennung und Status, aber auch Abwertung und Geringschätzung. Die Arbeit von Friseurinnen und Friseuren beruht auf solidem technisch-handwerklichen Fachwissen und Fertigkeiten – aber nicht nur auf diesen allein. Eine andere, weniger sichtbare Seite bezieht sich auf das Menschliche und Lebendige der Kunden – wie auch des Haares. Friseurinnen und Friseure interagieren und kommunizieren mit Kunden, ihre Arbeit ist so gesehen eine ›Interaktionsarbeit‹. Aber auch das Haar selbst ist keineswegs nur ein Gegenstand und lebloses Objekt. Es ist vielmehr höchst eigenwillig, eigensinnig und widerspenstig. Friseurinnen und Friseure müssen damit zurechtkommen. Sie benötigen ein ganz besonderes Gefühl und Gespür, um das Haar zu bändigen wie auch mit ihm ›zusammenzuarbeiten‹. Und schließlich werden bei der Arbeit mit dem Haar nicht nur unsere Haare, sondern auch wir selbst ›berührt‹. Friseurinnen und Friseure dringen immer auch in die Intimsphäre ein, und wir müssen dies zulassen und aushalten. All dies hat Einfluss darauf, wie das Werk von Friseurinnen und Friseuren gelingt und wie zufrieden wir sind. Wer an Fakten, Daten, Trends u. ä. interessiert ist, findet in diesem Buch auch aktuelle Informationen zur Lage und Entwicklung des Friseurhandwerks. Zunächst jedoch zur weiteren Einstimmung ein Gang durch ein Spiegelkabinett, in dem wir unterschiedlichsten Blicken auf das Haar begegnen. Alltagsspiegel 1 5 Alltagsspiegel »Wer kennt nicht die Mikrosekunde des scheuen Blicks in den Spiegel, der einem gegen Ende der Sitzung im Friseursalon hinter den Kopf gehalten wird, um das Werk des Friseurs oder der Friseurin aus der Panoramaperspektive abschließend zu beurteilen. Es ist die Aufgeregtheit der Generalprobe, mit der die Kundin oder der Kunde den Salon verlässt.«1 Für das Theater gilt die Regel, dass die verpatzte Generalprobe ein Garant für die gelungene Aufführung sei. Man mag das gar nicht zusammendenken mit dieser oben geschilderten Mikrosekunde, die wir ja alle kennen! Denn was passierte, wenn diese Generalprobe beim Friseur tatsächlich misslänge? Müssten wir nicht sofort aus dem Spiegelblick heraustreten und diese Mikrosekunde mit einem gar nicht scheuen, sondern höchst erregten Blick und dem Aufschrei beenden: »Scheren Sie sich zum Teufel, so geht das aber schon gar nicht!« Abgesehen von der fatalen Unumkehrbarkeit der in diesem Moment geschaffenen Gefühls-, und vielleicht sogar Lebenslage: Eine zutiefst persönliche, höchstwahrscheinlich äußerst erregte Auseinandersetzung mit der ›Fachkraft‹ wäre darüber hinaus wohl unvermeidlich. Und auch ›das Leben danach‹ wäre definitiv ein anderes. Denn wer kennt es nicht, sich bereits in dieser Mikrosekunde, noch heftiger meist kurz nach dem Verlassen des Tatorts, zumindest unwohl zu fühlen. In schlechteren Fällen sich selbst fremd, entfremdet – wenn nicht gar entstellt –, seiner Persönlichkeit richtiggehend beraubt! Oder, wie es die Literaturwissenschaftlerin Maria Antas beschreibt, »das Gefühl, meine Seele sei in den falschen Kopf eingezogen.«2 Wie gut, dass Theaterregeln nur für die Bühne gelten. Den Friseursalon auf der Bühne des wirklichen Lebens verlässt man ja meist in der positiven Aufgeregtheit – oder in der gewohnten Coolness –, den nächsten Alltagsauftritten einmal mehr mit gerichtetem Haupthaar und gestärktem Selbstbewusstsein ins Auge sehen zu können. Soziologen sagt man gelegentlich nach, sie würden ja noch aus der trivialsten Nebensache ein interessantes Phänomen oder zumindest einen ungewöhnlichen, jedenfalls meist schwer verständlichen Begriff konstruieren. Genau nach so etwas mag es klingen, wenn wir uns in diesem Buch mit soziologischem Blick ›dem Haar‹ zuwenden. Sind Haare doch, wie auch Friseurbesuche, auf den ersten Blick höchst nebensächliche, profane Alltagsangelegenheiten. Und auch dem Friseurberuf haftet ja, abgesehen von einigen Promi- und Starcoiffeuren, das Image eines zwar tren- 6 Wer kennt es nicht? – Eine Einführung digen, aber nicht gerade hoch eingestuften Handwerks an. Schließlich, um dem noch eine geschlechtsspezifische Krone aufzusetzen: Er ist ein Frauenberuf! Doch das Haar, das aus uns heraus und über uns hinauswächst, ist eben weit mehr als nur ein Hornfaden, der zur Hälfte aus Kohlenstoff und zu geringeren Anteile aus Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff und Schwefel besteht. Es ist ein Phänomen, das über seine anscheinende Alltäglichkeit auch deshalb weit hinausragt, als sich in ihm – so von Tilman Allert gesehen und formuliert – wie in einem Prisma die »Übergängigkeit von Natur und Kultur« abspielt.3 Will besagen: Natur und Kultur sind, seit es beide gibt, im Haar innig verknüpft. 2 Kulturspiegel Besäße das Haar lediglich seine – heute allerdings recht reduzierten – körperlichen Funktionen, verdiente es wohl kaum besonderer Betrachtung. Doch schon die Tatsache, dass man bereits in der Antike die Kahlköpfigkeit (Alopecia) nicht nur kannte, sondern sie verabscheute und mit Rezepturen zu überwinden suchte, macht auf den Umstand aufmerksam, dass es sich hierbei nicht nur um ein persönliches Leiden handelte, sondern weithin sogar um ein sozial wie kulturell unerwünschtes Phänomen. Es ist, wie die dänische Literatur- und Kulturhistorikerin Nina Bolt pointiert formuliert, vor allem die »kolossale psychologische Bedeutung« des Haares als »zentraler Teil unserer Körpersprache«, die dem Haar in der Tat einen besonderen Platz in der gesamten Geschichte des Menschen verschafft hat. Folgt man der Darstellung dieser Autorin und der von ihr zitierten ›Wasseraffentheorie‹, so sind die Haare des Menschen die ihm noch verbliebenen Fellreste. Durch die Schweißabsonderung habe er, der Mensch, ein alternatives Kühlsystem entwickelt, das seine Ganzkörperbehaarung – um im Wortspiel zu bleiben – zunehmend überflüssig machte. Seither sei die Behaarung zwar insgesamt geringer, das Haar aber, so der Untertitel ihrer kulturgeschichtlichen Betrachtung, für viele zur »wichtigsten Hauptsache der Welt« geworden.4 Haare sind, so lässt sich sagen, ein elementarer Bestandteil unserer menschlichen und kulturellen Körpersprache. Sie sind, so die Beschreibung des Kunsthistorikers Christian Janecke, »im Bunde mit dem Körper«. Dort aber, wo sie »den Körper engeren Sinnes verlassen«, werden die Haare »Gegenstand expliziter kultureller Überformung; erstens in symboli- Wissenschaftsspiegel 7 schen Deutungen, zweitens in der Physiognomik, drittens in der Verwertung als Rohstoff, etwa für Perücken, für Kleidung, für Schmuck, viertens in der Haarpflege«.5 Die Haare spielen in Mythen, Sagen, Märchen, Romanen, Gedichten, Theaterstücke
Oralvergnügen und Fick mit Doktor und Negerin
Die Frau des Millionärs reitet einen Gummischwanz in einem Schlafzimmer
Ficken in einer Krebspose einer alten Oma und eines Mannes mittleren Alters