Ritt auf dem Musiklehrer
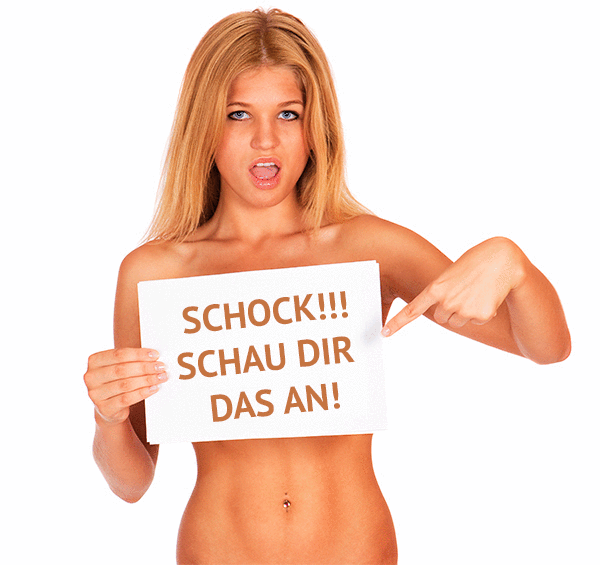
🛑 ALLE INFORMATIONEN KLICKEN HIER 👈🏻👈🏻👈🏻
Ritt auf dem Musiklehrer
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie auf Ihre Interessen abgestimmte Inhalte sowie unsere vielseitigen Newsletter.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie auf Ihre Interessen abgestimmte Inhalte sowie unsere vielseitigen Newsletter.
Jetzt Mitglied werden! Erleben Sie WELT so nah wie noch nie.
Home Print WELT AM SONNTAG Dein Lehrer ist dein Schicksal
WELT AM SONNTAG Dein Lehrer ist dein Schicksal
Veröffentlicht am 28.08.2016 | Lesedauer: 19 Minuten
Über keine Berufsgruppe wird so viel Hohn und Spott ausgeschüttet wie über Lehrer. Dabei geben sie oft entscheidende Anstöße im Leben. Reinhard Mohr hat mit dem Politiker Cem Özdemir, der Schriftstellerin Thea Dorn und dem Kabarettisten Horst Schroth über den wichtigsten Menschen in ihrer Kindheit gesprochen
WIR IM NETZ Facebook Twitter Instagram UNSERE APPS WELT News WELT Edition
S obald es um die Schule geht, ist es wie beim Fußball: Jeder ist Experte. Jeder weiß, wie es richtig geht und was alles schiefläuft zwischen Pisa und L.I.S.A., jeder hat seine Geschichten auf Lager, jeder hat eine Meinung. Schließlich war jeder mal Schüler oder Schülerin, und die Begegnung mit Lehrern kann fürs Leben prägend sein, Trauma inklusive.
Der Lehrerwitz ist ein eigenes Fach, die Filme über Lehrer sind Legende – von der „Feuerzangenbowle“ bis zu „Fack ju Göhte“, von „Die Lümmel von der ersten Bank“ bis zum „fliegenden Klassenzimmer“. In den 90er-Jahren stapfte „Unser Lehrer Doktor Specht “ als Post-Achtundsechziger mit linksliberaler Umhängetasche durch die endlosen Linoleumflure der progressiven Penne – der beste Freund seiner Schüler, auch wenn die es oft nicht einsehen wollten.
Keine andere Berufsgruppe zieht so endemisch Hohn und Spott auf sich, und in Zeiten der sogenannten sozialen Medien sind anonyme Anschwärzerei und gemeine Verunglimpfung zum Volkssport geworden. Selbst der alte Goethe, der mangels Facebook-Account auf persönliche Gespräche mit Friedrich Wilhelm Riemer zurückgreifen musste, sagte demselben anno 1817 in ungnädiger Kürze: „Pfaffen und Schulleute quälen unendlich.“
Acht Jahrzehnte später erlebte Stefan Zweig seine Lehrer als „arme Teufel, die sklavisch an das Schema, an den behördlich vorgeschriebenen Lehrplan gebunden, ihr ‚Pensum‘ zu erledigen hatten wie wir das unsere und – das fühlten wir deutlich – ebenso glücklich waren wie wir selbst, wenn mittags die Schulglocke scholl, die ihnen und uns die Freiheit gab“.
In Thomas Manns Jahrhundertroman „Buddenbrooks“ wird Hannos Lehrer Dr. Mantelsack als ein Tyrann mit dünnem Haar und einem „krausen Jupiter-Bart“ geschildert. Und in Heinrich Manns „Professor Unrat“, 1930 von Josef von Sternberg unter dem Titel „Der blaue Engel“ zum Klassiker verfilmt, mutiert der bösartige Gymnasiallehrer Raat zum gnadenlosen Feind seiner Schüler.
Doch merkwürdig: Der Lehrer – selbstverständlich auch die Lehrerin, die hier stets mitgemeint ist – ist auch ein Held der Jugend, ein Leuchtturm der Kindheit, ein früher Anker des Lebens. Nicht wenige erinnern sich an ihren wichtigsten Lehrer als einen, der ihnen ganz entscheidende Anstöße gab, ihnen Türen ins Leben aufstieß. Und mehr als das – als ein Bild in der Seele, das Vorbild zu nennen nicht völlig übertrieben wäre.
Für den Kabarettisten und Schauspieler Horst Schroth war Fräulein von Reitzenstein das Idealbild einer Klassenlehrerin, damals, 1955, in der Grundschule im oberfränkischen Münchberg. „Sie war liebenswürdig und verständnisvoll“, erzählt Schroth, „und für mich die schönste Frau der Welt“. Später, am Gymnasium in Baden-Württemberg, ging es schon anders zu. Der Lateinlehrer war ein ehemaliger Offizier der Nazi-Wehrmacht mit Holzbein und Stock.
Den benutzte er schon mal, „um dazwischen zu hauen“. Alte Schule eben. „Mir schlug er einmal freundschaftlich auf den Kopf, als ich überraschenderweise eine Eins geschrieben hatte. ‚Du kannst es doch!‘, schnaubte der Ex-Offizier ebenso wütend wie anerkennend.“ Von posttraumatischen Störungen unter Schülern, die durch diese paramilitärische Pädagogik à la Käpt’n Ahab hervorgerufen sein könnten, ist Schroth nichts bekannt.
„Wir nahmen das als sportliche Herausforderung. Das Holzbein war ja auch unser Hockeytrainer.“ Der Mathelehrer war dagegen ein echter Sadist, der in zwangsneurotischer Konsequenz auf extrem gespitzte Bleistifte und winkelgerecht bereitliegende Geodreiecke, Zirkel und Kurvenlineare achtete. „Er hatte Spaß, wenn er Sechsen verteilen konnte, echte Freude, wenn er Schüler scheitern sah. Dabei verstehe ich bis heute nicht, wozu man die Kenntnis von Winkelfunktionen braucht.“
Mit dieser Frage ist Horst Schroth nicht allein. Sein heutiges Spezialgebiet liegt sowieso woanders: „Wenn Frauen fragen“ heißt eines seiner erfolgreichsten Programme. Aber ein Herz für Pauker hat er auch. „Null Fehler: Lehrer Laux – das Comeback!“ heißt sein aktuelles Soloprogramm. Das ganze neurotische Potenzial strammer Studienräte entfaltete sein Zeichenlehrer, als ein Mitschüler einmal ein Blatt komplett in blaue Farbe getaucht hatte. Offenbar Opfer eines tiefsitzenden Yves-Klein-Komplexes, zerriss der Pädagoge unter frenetischen Rufen wie „Nicht bei mir!!!“ das Werk in tausend Stücke, warf es auf den Boden und trampelte wie Rumpelstilzchen darauf herum. Es war ein Riesenskandal.
Kein Skandal war damals die Äußerung eines zweiten Mathelehrers, Junggeselle, Sachse, Ex-Wehrmachtsoffizier auch er. Er fuhr jeden Tag mit dem Taxi zur Schule und las dabei gern Schüler vom Wegesrand auf. Hatte er am Vorabend in der „Bonbonnière“ wieder einmal zu ausgiebig gezecht, musste ein Schüler Sprudelwasser holen. Wenn leere Milchflaschen zurückgebracht werden sollten – das Recycling-System der frühen Jahre –, hieß es für die fleißigen Pennäler, die militärische Form zu wahren. Sie mussten an die Tür des Klassenzimmers klopfen, nach Aufforderung eintreten und in korrekter Haltung Kunde geben: „Melde mich mit einem Kameraden vom Milchdienst zurück!“ Wurde die Nachricht schmissig genug vorgetragen, gab es zur Belohnung Anekdoten aus dem Zweiten Weltkrieg, gern Geschichten aus den „Wolliner Sümpfen“ tief hinten in der Ukraine. Wenn dann die Luft im Klassenraum zu stickig wurde, rief der Oberstudienrat im besten Sächsisch: „Macht das Fenster auf, hier riecht es ja wie in einem mazedonischen Wanderpuff.“
Was heute dazu führen würde, dass binnen Stunden mehrere Rechtsanwälte und die lokale Antidiskriminierungsstelle auf den Plan träten, hinterließ damals allenfalls ein Gekicher auf dem Pausenhof. Mitte der sechziger Jahre lag das Kriegsende gerade mal fünfzehn Jahre zurück, und so war es völlig normal, dass der Deutsch- und Musiklehrer, etwa am Wöhler-Gymnasium in Frankfurt am Main, bei herannahender Tiefdrucklage seinen Granatsplitter im Kopf schmerzhaft spürte und den Buben bei der Gelegenheit noch einmal anschaulich erklärte, wie die Handgranate nach sachgerechter Lösung des Sicherheitsbügels so präzise wie möglich in Richtung der russischen Kampflinien geworfen werden musste. Die Schüler freuten sich: Je ausführlicher die Schilderungen von der Ostfront, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, beim gefürchteten Vorsingen a cappella doch noch dranzukommen.
Aber auch damals gab es eingefleischte Zivilisten am Pult. Am Ende traf Horst Schroth auf einen Deutschlehrer ohne Holzbein und Granatsplitter, der es verstand, sein Interesse an Kunst und Literatur zu wecken. „Er ist schuld daran, dass ich heute bin, was ich bin.“ Damit spricht der Kabarettist aus, was die Wissenschaft heute weiß: Auf den Lehrer kommt es an.
2009 veröffentlichte der neuseeländische Bildungsforscher John Hattie eine umfangreiche Untersuchung, die als Buch unter dem Titel „Visible Learning“ erschien. Über 800 Studien über schulisches Lernen weltweit hatte er analysiert. Ergebnis: Entscheidend für den Lernerfolg der Schüler sind weder Klassengröße noch soziale Herkunft, weder die Art der Schule noch Lehrpläne oder die jeweilige Bildungspolitik – es ist, ganz einfach, die Qualität des Lehrers.
In Schweden gab es 2010 ein vom Fernsehen über fünf Monate begleitetes Schulexperiment, bei dem ein Team um den zypriotischen Mathematiklehrer Stavros Louca eine sehr leistungsschwache Klasse übernahm. Am Ende rangierte sie an der Spitze des landesweiten Leistungsniveaus. Auch die deutschen Bildungsökonomen Hendrik Jürges und Kerstin Schneider haben herausgefunden, dass ein hervorragender Unterricht nahezu alle sozialen Unterschiede „wegschleifen“ kann: „Hat ein Kind aus einkommensschwachen Verhältnissen für fünf Jahre einen sehr guten Lehrer, so gleichen sich seine Bildungschancen im Vergleich zu einem Kind aus einer wohlhabenden Familie mit nur mittelmäßigem Lehrer aus.“
Doch was macht einen guten Lehrer eigentlich aus? Vier Dinge scheinen es vor allem zu sein: Fachwissen, didaktische Fähigkeiten, Geschick im Umgang mit Eltern und Leidenschaft für den Beruf. Gewiss auch gute Nerven, versteht sich. Aber es gibt da noch etwas, was womöglich wenig mit der akademischen Lehrerausbildung zu tun hat: natürliche Autorität, pädagogisches Charisma, persönliche Ausstrahlung, altertümlich gesprochen: Charakter.
Cem Özdemir, Bundesvorsitzender der Grünen, hatte so einen Lehrer in Deutsch, Mathe und Musik – Herrn Simader, den er heute noch besucht: „Seit ich fünfzig geworden bin, zieht es mich immer wieder in die alte Heimat, um ehemalige Lehrer und Schulkameraden zu treffen.“
Özdemir, 1966 als Kind türkischer Einwanderer im schwäbischen Bad Urach geboren, war „ein lausiger Schüler“, wie er selbst sagt. „Ich war faul und hatte keinen Bock“, erzählt er in seinem Büro in der Berliner Bundesgeschäftsstelle der Grünen. „Die fünfte Klasse musste ich wiederholen.“ Stets verzog er sich in die hinterste Bank. „Im Grunde habe ich immer für den Lehrer gelernt. Schon in der ersten Schulstunde wusste ich, ob es sich lohnt oder nicht.“
Bei Herrn Simader hat es sich über alle Maßen gelohnt. Obwohl er ihn in Mathe nur ein einziges Jahr hatte, verbesserte er sich in dieser Zeit von der Note 5 auf eine 3. Viel wichtiger noch: Er lernte bei ihm den Wert von Zweifel und Widerspruch, eine unabdingbare Voraussetzung der Fähigkeit, eigenständig zu denken. Dabei war Herr Simader ein klassischer Linker der Nach-68er-Zeit, der Sympathien für die Sowjetunion hegte. Doch trotz seiner ideologischen Strenge ließ er den Zweifel auch an seiner politischen Überzeugung zu. „Mit Schmusepädagogik hatte das aber nichts zu tun. Da ging es schon zur Sache.“
Manfred Simader selbst erinnert sich heute noch daran, dass er im Deutschunterricht Jakob Wassermanns Novelle von 1923 „Das Gold von Caxamalca“ behandelte, in der es um das Reich der Inka, den spanischen Eroberer Francisco Pizarro und die katholische Kirche ging, um das alte Europa und das Erbe des Kolonialismus. Irgendwann erwähnte Simader dann die „Grauen Wölfe “, eine Organisation rechtsextremer türkischer Nationalisten. „Was sind Graue Wölfe?“, habe Özdemir damals gefragt. „Cem hat zu Hause seinen Eltern davon erzählt. Die waren gar nicht begeistert. Doch gerade die Auseinandersetzung mit diesem Thema hat sein Politikinteresse geweckt. Cems Vater hat sich immer um die Schulangelegenheiten seines Sohnes gekümmert. Ich habe ihn als ungeheuer beeindruckenden Menschen kennengelernt.“
Einmal aber musste der Lehrer seinem Schüler ganz praktisch „eine Lektion in Demokratie erteilen“, wie er sagt. Es ging um einen „Raucherraum“ für Schüler, an dessen Herrichtung sie sich freilich beteiligen sollten. Schülervertreter Özdemir lehnte das ab, und als Simader ihn daran erinnerte, dass die Alternative dann eben ein komplettes Rauchverbot in der Schule wäre, antwortete der spätere Grünen-Chef mit dem basisdemokratischen Refrain jener Jahre: „Ja, dann diskutieren wir das noch einmal!“
Dennoch sollte sich das Motto bewähren. Als Simader für die sowjetische Invasion in Afghanistan 1979/80 deutlich mehr Verständnis aufbrachte als für den Krieg der Amerikaner in Vietnam , stellte der 14-jährige Cem schon die eine oder andere Frage. Erst recht, als ein Abgesandter des „Bundesverbandes für Selbstschutz“ im Unterricht Vorkehrungen für den Fall eines Atomschlages erläuterte, die („Schultasche in Kopfhöhe halten!“) durchaus satirereif war.
„Hilft das wirklich? Was passiert am Tag danach?“ Da der Schüler Özdemir keine Antworten bekam, schrieb er einen Leserbrief an die Südwestpresse. Daraufhin berief der Schulleiter eine Sonderkonferenz der Schülermitverwaltung ein und entschuldigte sich persönlich bei den anwesenden Atomabwehr-Spezialisten. Es waren jene Zeiten, als der stockkonservative Gerhard Mayer-Vorfelder Kultusminister war. „Wenn beim Spiel Bayern gegen Cottbus nur zwei Germanen in den Anfangsformationen stehen, kann irgendetwas nicht stimmen“, sagte er später als Präsident des Deutschen Fußballbundes.
Dennoch wurde Özdemir kein anständiger Linksradikaler: „Aus mir ist nie ein guter Marxist geworden.“ Kein Wunder, die schulische Autorität, mit der er konfrontiert war, hatte ja schon an der Uni, in der Basisgruppe Germanistik, das „Kommunistische Manifest“ gebüffelt. Anders als bei der Generation zuvor kamen die Lehrer eben nicht mehr aus den Schützengräben des Weltkriegs, sondern von Universitäten, an denen, jedenfalls in den Geisteswissenschaften, der Zeitgeist scharf links wehte.
Ein einschneidendes Erlebnis war ein Referat über revolutionäre Widerstandsbewegungen in El Salvador. Beim Durcharbeiten der Unterlagen schwirrte Özdemir schnell der Kopf von all den Abspaltungen, Fraktionskämpfen und taktischen Pakten der verschiedenen trotzkistischen, maoistischen und „revisionistischen“ Gruppen und Grüppchen. „Ich musste beim Lesen immer wieder von vorne anfangen, weil ich nach ein paar Seiten schon wieder vergessen hatte, welche Fraktion sich wann gegen wen verbündet hatte.“ So stellte er sich schon im zarten Alter von fünfzehn die Frage, ob es gut sei, wenn solche Leute die Regierungsmacht übernähmen.
Ein Kontrastprogramm zu dieser Lektion der Selbstaufklärung erlebte Özdemir, als er zwei Jahre lang „muttersprachlichen Ergänzungsunterricht“ in der türkischen Schule genoss. Eine Rückkehr in die Türkei war ja nicht ausgeschlossen. Das offizielle Lehrbuch war eine Art Atatürk-Bibel – alle paar Seiten ein großes Porträt des Staatsgründers der modernen Türkei. Dazu ging es im Unterricht ständig um historische Siege einstiger Sultane und Großwesire des ehedem Osmanischen Reiches, während dessen Staatsgebiet jedoch ständig schrumpfte.
„Auf der Karte wurde das Reich immer kleiner“, erinnert sich Özdemir. Als er den Lehrer auf diesen Widerspruch hinwies, setzte es eine Ohrfeige – noch eine prägende Erfahrung, die ihn „gegen jeden Heldenkult“ immunisierte und eindrucksvoll bewies, wie wichtig geistige Freiheit ist, die ohne Selbstreflexion nicht auskommt. Am Ende kam dann die große Kränkung. „Ich möchte aufs Gymnasium“, sagte der Realschüler Cem im Angesicht der Klasse. Da lachte nicht nur der Lehrer, auch die meisten Mitschüler amüsierten sich wie Bolle. „Das hätte ich früher am Anfang unseres Gesprächs erzählt“, sagt Özdemir. „Heute erzähle ich es zum Schluss.“
Es immer gleich anfangs zu erzählen, hieße: als Generalvorwurf des Zugewanderten an eine durch und durch unfaire Mehrheitsgesellschaft. Es abschließend zu erzählen, heißt: als anekdotisches Dessert von einem, der es geschafft hat. Denn das hat er. Cem Özdemir ist ein Aufstiegskind par excellence, der über das Fachabitur zum Studium der Sozialpädagogik fand und heute an der Spitze einer Partei steht, die im Herbst 2017 den Vizekanzler stellen könnte.
Wilhelm Busch war das alles schon vor 150 Jahren sonnenklar: „Also lautet ein Beschluss: Dass der Mensch was lernen muss“, reimte er im Präludium des vierten Streichs von Max und Moritz. „Nicht allein im Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig‘ Wesen; Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen; sondern auch der Weisheit Lehren, muss man mit Vergnügen hören. – Dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lämpel da.“
Dem Lämpel wurde allerdings, wie wir wissen, von den bösen Buben übel mitgespielt. Doch sein Leiden hatte, genauso wie die herrlich schrullige Welt der „Feuerzangenbowle“ mit der missglückten alkoholischen Gärung im Chemieunterricht – „Es war doch nur ein wööönziger Schluck!“ –, noch eine romantisch-ironische, eben eine literarisch-metaphysische Anmutung, auch wenn es gehörig puff-puff machte.
Heute dagegen geht es stramm prosaisch zu, viel zu oft missgelaunt und verkrampft, Spiegelbild einer Schul- und Bildungsbürokratie, die den Lehrern – von der Integration bis zur Inklusion – immer neue Aufgaben aufbürdet. Die 38-jährige Lehrerin einer Grundschule in Schleswig-Holstein schrieb im Magazin „Coeur“ im Mai 2015, sie sei so „desillusioniert und belastet“, dass sie sich nach beruflichen Alternativen umsehe.
Besonders zu schaffen machten ihr die „extremen Verhaltensauffälligkeiten“ der Schüler, ihr „eklatanter Mangel an Konzentration und Anstrengungsbereitschaft“, „innere Unruhe“ als Dauerzustand. Das Respektsverhältnis gegenüber den Lehrern sei erodiert, Regelverstöße blieben oft ohne Konsequenzen – „Symptome gesellschaftlicher Veränderungen“, die den einzelnen Lehrer heillos überfordern. Ob man all das, wenn auch in anderen Worten, auch über die renitente Klasse von Oberprimaner Hans Pfeiffer („Ein f vor dem Ei, zwei dahinter“) alias Heinz Rühmann hätte sagen können? Oder über die „Lümmel von der ersten Bank“?
Schwer zu sagen. Claudia Ludwig, langjährige Lehrerin, die heute als Kommunikationstrainerin arbeitet, klagt vor allem über den modischen Reformwahn mit „offenem Unterricht“, bei dem der Lehrer nur „Moderator“ sei. Zum Bürokratie-Irrsinn gehörten auch „Evaluationsbögen“ für jeden Schüler und „Lernzielkontrollen“ schon in der ersten Klasse.
Dazu kommen kreative Neuerungen wie die „Lautierungsmethode“ beim Erlernen der Schriftsprache, eine Erfindung des Schulpsychologen Norbert Sommer-Stumpenhorst. Der gute alte Marienkäfer wird dann, frei nach Gehör, Wille und Vorstellung, als „Marinkefa“ in die lauen Lüfte entlassen. Wenn ab der dritten Klasse orthografisch korrekt geschrieben werden muss, ist die Not der Semi-Analphabeten groß, die diese Lernmethode geradezu züchtet – fatal vor allem in „Brennpunktschulen“ mit vielen Migranten- und Flüchtlingskindern.
Rüdiger Dammann, einst Lektor beim Rowohlt Verlag, heute freier Autor, Berater und Chefredakteur des „Coeur“-Magazins, hat jahrelang an Berliner Brennpunktschulen in Wedding und Neukölln praktischen Beistand geleistet und versucht, Schülerinnen und Schülern die Vorzüge einer demokratischen Gesellschaft nahezubringen. Er teilt die Diagnose „großer Autoritätsprobleme“, mit denen vor allem Lehrerinnen konfrontiert seien, meist durch muslimische Jungen. Die multikulturelle Heterogenität einzelner Klassen fördere nicht unbedingt die Konzentrationsfähigkeit. Und ja, desinteressierte, oft arbeitslose und des Deutschen nicht mächtige Eltern ohne Aufstiegs- und Bildungsperspektiven trügen das ihre zu den massiven Lese- und Rechtschreibschwächen ihrer Kinder bei.
In der Freizeit, so Dammann, herrsche dann „eine bizarre Mischung aus stundenlangem Computerspiel und Koranunterricht in der Moschee“. Sein Fazit zur Rolle des Lehrers von heute: Er müsse eine Art „Showmaster“ sein, nicht als Kumpel der Schüler, sondern in der schwierigen Lage, was er tut, immer wieder begründen und rechtfertigen zu müssen. Irgendwie kämpft eben auch er mit der Einschaltquote.
Das war noch anders, als der junge Andreas Rebers in der Realschule zu Bodenwerder im tiefsten Niedersachsen sich vom Chemielehrer Fink regelmäßig seine „Kopfnüsse“ abholte. In seinen autobiografischen Skizzen „Der kleine Kaukasus“ (Köln 2011) schildert der Kabarettist, Jahrgang 1958, die klassische Arbeitsweise seines damaligen Physiklehrers, den alle nur „Oppa“ nannten: Aus dem Lehrbuch, das alle vor sic
Maskiertes Babe kriegt es hart
Guter Fick beim ersten Date
Lecke meine Muschi hart Teil drei