Mutter unterstützte ihren Sohn, als er von einem Mädchen verlassen wurde
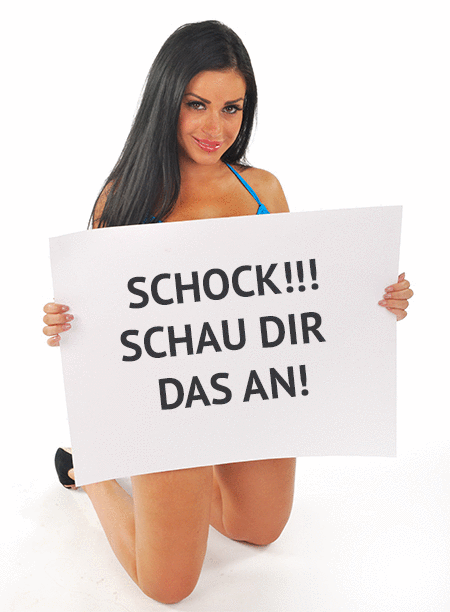
🔞 ALLE INFORMATIONEN KLICKEN HIER👈🏻👈🏻👈🏻
Mutter unterstützte ihren Sohn, als er von einem Mädchen verlassen wurde
Menü öffnen/schließen
Startseite
Suche
Inhaltsangaben
Aufsätze gruppiert nach...
... Epochen & Strömungen
... Autoren & Dichter
... Gedichten & Werken
... Themen
Liste aller Aufsätze
Podcasts
English translations
Impressum
Bisherige Besucher-Bewertung: 13 Punkte, sehr gut (-) (13 Punkte bei 32 Stimmen) Deine Bewertung: 15 Punkte, sehr gut (+) 14 Punkte, sehr gut 13 Punkte, sehr gut (-) 12 Punkte, gut (+) 11 Punkte, gut 10 Punkte, gut (-) 9 Punkte, befriedigend (+) 8 Punkte, befriedigend 7 Punkte, befriedigend (-) 6 Punkte, ausreichend (+) 5 Punkte, ausreichend 4 Punkte, ausreichend (-) 3 Punkte, mangelhaft (+) 2 Punkte, mangelhaft 1 Punkt, mangelhaft (-) 0 Punkte, ungenügend Bewertung abgeben
News / Blog Neuigkeiten, Ablage für Diverses
Inhaltsangaben Inhaltsangaben & Zusammenfassungen
Epochen Interpretationen und Analysen nach Literatur-Epochen geordnet
Autoren & Dichter Interpretationen und Analysen nach Autoren geordnet
Gedichte & Werke Interpretationen und Analysen nach Titeln geordnet
Themen Interpretationen und Analysen nach Themen geordnet
Übersicht Übersicht aller Interpretationen
English translations Overview of contributions in English
Die nachfolgende Inhaltsangabe und Kapitelzusammenfassung bezieht sich auf Sindiwe Magonas Buch „Auerhaus“. Es wurde je Kapitel eine kurze Zusammenfassung erstellt.
Eine konkrete Definition der Gegenwartslyrik gestaltet sich als schwierig, da wir uns gegenwärtig noch in dieser Epoche befinden. Bei den meisten vorangegangenen Epochen war es den Dichtern nicht bekannt, wie ihre Epoche heißt und wo sie zeitlich einzuordnen ist. Der Name einer Epoche und welche Hauptmerkmale sie besaßen, wurden erst im Nachhinein erforscht und herausgearbeitet.
Im Moment kann man sagen, dass die Werke der Gegenwartslyrik so vielfältig sind, wie das Leben der heutigen Dichter selbst. Während andere Epochen teilweise von nur wenigen herausragenden Dichtern, also einer konzentrierten Künstlergruppe geprägt wurden, sieht man sich heute noch einer undeklarierbaren Menge von Lyrikern aller Herkunft und Stilrichtungen gegenüber. Zudem tauchen immer mal wieder Merkmale und Gedichte des Expressionismus, des Barocks oder anderen Epochen auf, sodass man die Charakteristika heutiger Lyrik schwer filtern und verdichten kann.
Lehrbuchmäßige Definition der Gegenwartslyrik beschreiben unsere heutige Lyrik als relativ formfrei. Der Inhalt ist dabei für den Leser häufig konkreter und es wird mehr auf Alltäglichkeiten eingegangen, als bei der traditionellen Lyrik. Dadurch, dass die Form des Gedichts freier ist, wird weniger Wert auf formale Aspekte wie Reimschema, Metrum, rhetorische Figuren oder der Sprachästhetik gelegt.
Sindiwe Magona ist eine südafrikanische Lehrerin, Schriftstellerin, Frauenrechtlerin und UN-Mitarbeiterin, die als älteste von sieben Geschwistern im Township Gugulethu bei Kapstadt aufwuchs. Magona wurde früh schwanger, heiratete ihrem Ehemann aus Not und wurde von ihm mit 23 verlassen, als sie gerade mit dem dritten Kind schwanger war. Während dieser Zeit arbeitete Magona als Haushaltshilfe, bis sie durch sekundäre Schulbildung die Beschränkungen ihrer Herkunft hinter sich lassen konnte. Magona widmet sich in ihrer literarischen Arbeit u. a. dem Leben als (schwarze) Frau und der Arbeit als Hausangestellte, der Armut und dem Widerstand gegen das Apartheidsystem. Magona hat aber auch Gedichte und Novellen, Erzählungen, Kinderbücher und Theaterstücke sowie eine Autobiografie verfasst; sie engagiert sich u.a. für die Erhaltung ihrer Muttersprache isiXhosa in der schriftlichen Literatur.
Der 1998 veröffentlichte Roman Mother to Mother ist Magonas vierter Roman. Sindiwe Magona verarbeitet in diesem Roman einen realen, sehr tragischen Todesfall:
Die (weiße) Amerikanerin Amy Elizabeth Biehl war Studentin der Stanford University und im Rahmen eines Fulbright-Stipendiums (akademisches US-Austauschprogramm Völkerverständigung) nach Südafrika gegangen, um bei der Organisation der ersten demokratischen Wahlen im Land zu helfen. In der Zeit kurz vor dem Ende der staatlich verordneten Apartheid kam es im ganzen Land immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Schwarzen und Weißen. Amy Biehl geriet in eine solche Auseinandersetzung, als sie am 25. August 1993 Freunde mit dem Auto nach Hause ins Township Gugulethu fuhr. Sie wurde von einem „schwarzen Mob“ aus dem Auto gezerrt, gesteinigt und schließlich erstochen. Die Apartheid wurde mit der ersten demokratischen Wahl am 27. April 1994, nach der Nelson Mandela im Mai zum Präsidenten gewählt wurde, tatsächlich offiziell beendet - einen Tag, nachdem Amy Biehl ihren 27. Geburtstag gefeiert hätte.
Als Sindiwe Magona erfuhr, dass der Roman von den deutschen Schulbehörden als Unterrichtsstoff ausgewählt wurde, zeigte sie sich sehr erfreut darüber. Beim Kontakt mit den deutschen Verlegern gab Sindiwe Magona den deutschen Schüler:innen folgende Worte mit auf den Weg: Sie hoffe sehr, dass die Schüler:innen nach der Beschäftigung mit dem Roman besser verstehen können, warum das Ende der Apartheid mit Gewaltausbrüchen einherging (einhergehen musste), die auch vor gutgesinnten, freundlichen Menschen keinen Halt mehr kannten.
Sindiwe Magona wohnt in Gugulethu, der Mord an Amy Biehl fand ganz in der Nähe ihres Wohnhauses statt, die Mörder waren die Söhne ihrer Nachbarn. Als Magona unter dem Schock der Gewaltwelle, die am 25. August durch das Township fegte, über den Mord an der weißen Aktivistin nachdachte, dachte sie auch an ihren ihren eigenen Sohn. Wie leicht hätte auch er zum Mörder werden können in der durch die Apartheid verursachten und immer noch nachwirkenden Gewaltatmosphäre ...
Aus diesen Gedanken ging die Erzählform des Romans hervor: Mandisa, die Mutter eines der Mörder, richtet sich im Selbstgespräch bzw. einem fiktiven Brief an die Mutter des Opfers. Mandisa beschreibt der weißen Frau ihr Leben und das Leben des Sohnes, mit allen Demütigungen und der Gewalt als tragische Folgen der Apartheidgesellschaft. Sie möchte dieses Klima, in dem kein friedliches Leben möglich ist, der Mutter des Opfers vermitteln, um ihrer beider Schmerzen zu lindern.
Um aus dem Tod von Amy Biehl zu lernen, müsse diese (der Leser) die Welt voller Menschen kennenlernen, die das Gegenteil solch wohlwollender, fürsorglicher Personen sind. Wir sollen die Welt von Mörder kennenlernen, die so jung sind wie ihre Opfer, weil sie zu „verlorenen Kreaturen der Bosheit und der Zerstörung“ erzogen wurden.
Das erste Kapitel ist in Kursivschrift geschrieben, wie jeder Text im Roman, in dem Mandisa die Mutter des Opfers anspricht. Mandisa klagt ihr als Mutter des Mörders sehr emotional ihr Leid. Sie erklärt, warum sie die Kontrolle über ihren Sohn (Mxolisi) schon verloren hat, bevor er gezeugt wurde und sie spricht vom Klima in ihrer Gemeinschaft, das aus Kampf und gegenseitigem Töten bestehe. So ist sie auch nicht überrascht vom Mord, sondern habe habe schon lange gewusst, dass ihr Sohn eines Tages jemanden (Geschwister, Freunde) verletzen oder umbringen würde.
Mandisa sagt der fremden Mutter, dass Amy Gugulethu und ähnliche Townships besser gemieden hätte, weil sie dann nicht von ihren Sohn oder einem anderen „dieser Monster, zu denen unsere Kinder geworden sind“ getötet worden wäre. Mandisa klagt die Regierung an, weil ihr Sohn im Gefängnis besser versorgt wurde als zu jemals vorher, und wendet sich direkt an Gott, der ihr eine zu große Last aufgebürdet habe. Mandisas Klagelied endet, indem sie um Vergebung für ihren Sohn Mxolisi bittet.
Mandisa stellt sich das Leben von Amy vor, beginnend beim Frühstück am Morgen der Tat: Ein herrliches Frühstück, das Mandisa in allen Einzelheiten schildert, Auftakt zu einem schönen Tag im satten, vollen, verwöhnten Leben einer großen und starken, gut gelaunten und zuversichtlichen jungen Studentin.
Es folgt eine Schilderung von Mxolisis Leben, der spät aufsteht, weil er nicht weiß, warum er überhaupt aufstehen sollte. Das Frühstück aus Brot und Obst schmeckt ihm nicht. Das Geld für Eier muss seine Mutter ablehnen, weil sie als Haushaltshilfe bei Weißen nicht genug verdient, um normale Nahrung kaufen zu können. Ihre Kinder gehen alle nicht zur Schule, Mandisa erklärt die gesellschaftlichen Umstände, die dahinter stecken. Sie reflektiert weitere Details ihrer Einflussnahme auf Mxolisi, die ohne Erfolg blieben und schildert weitere Details aus Mxolisis Leben, das nur aus Schwierigkeiten besteht und niemals Anerkennung bereit hält.
Die Verflechtung der beiden Leben wird so lange fortgeführt, bis Amy ihren langen Tag der Verabschiedung von vielen Freunden fast hinter sich hat. Da sie am nächsten Tag zurück in die USA reisen will, will sie ihre Freundin unbedingt nach Hause ins Township fahren, um mit ihr den letzten Tag zu feiern. Dort treffen sie auf Mxolisi, der eigentlich schon mit wenigen anderen auf den Bus nach Hause wartet. Vorher war er seinen Freunden sinnlos durch die Gegend gezogen, weil ihnen die Nutzung des Versammlungsortes in der Kirche nicht spontan zugesagt wurde. Sie haben andere umherstreifende Jugendliche getroffen, sich mit ihnen die Beute aus einem ausgebrannten, geplünderten Bus geteilt, hatten sich aber fast schon wieder getrennt, als sie auf das Auto mit dem (laut Mandisa singenden) weißen Mädchen treffen ...
Mandisa führt uns in das reiche Leben der weißen Frau ein, für die sie arbeitet, und schildert vor diesem Hintergrund das typische Arbeitsleben einer schwarzen Haushaltshilfe. Am Mittwoch hat ihre weiße Arbeitgeberin ihren Fitness- und Shoppingday mit Freundinnen, sodass Mandisa ganz in Ruhe putzen, waschen und kochen kann. An diesem Mittwoch nicht: Ihre Arbeitgeberin kommt früher nach Hause, um Mandisa selbst mit dem Auto zum Zug nach Hause zu bringen. Ohne Widerrede, obwohl Mandisa noch nicht fertig mit dem Kochen ist: Es gebe Ärger in Gugulethu, sie sollte besser sofort heimfahren.
Auf dem Bahnhof ist große Unruhe, was nicht ganz unüblich ist, weil es in Gugulethu Unruhen gibt, seit die Schwarzen 1968 ins Township zwangsumgesiedelt wurden. Die Atmosphäre ist nur noch unruhiger als sonst ... Mandisa beschreibt uns ihr hässliches und heruntergekommenes, mit winzigen Häusern eng bebautes Township, das auch seine Bewohner asozial macht. Sie setzt es in Kontrast zu ihrem ursprünglichen Zuhause Blouvlei, wo Eltern und Kinder und Nachbarn miteinander in Gemeinschaft lebten; während es in Gugulethu allenfalls ein Überleben gibt. Oder auch nicht - als Mandisa von einem Auto mit UWC -Schülern erfährt, das möglicherweise ganz in der Nähe ihres Hauses gesteinigt, umgeworfen und angezündet wurde, macht sie sich große Sorgen um ihre Kinder und vor allem um ihren Sohn Mxolisi.
Mandisa, die unterwegs im Getümmel einen Schuh verloren hat, kommt voller Sorge zu Hause an. Sie will etwas über den Hintergrund der allgemeinen Unruhe erfahren - und doch eigentlich nichts darüber hören. Die Ahnung der Tochter, dass Mxolisi etwas mit dem Vorfall zu tun haben könnte, wird von ihr wütend als mangelnde Sorge um den Bruder interpretiert; die Tatsache, dass die (aufgeregte, verwirrte) Tochter ihren Zustand nicht bemerkt, als hochmütige Gleichgültigkeit gegenüber ihrer Person.
Der Nachbarin nimmt sie schon ihr Erscheinen übel, die Frage nach dem fehlenden Schuh noch mehr. Sie fährt die Nachbarin an, was sie (die Daheimgebliebenen) mit ihrem schönen Township gemacht hätten, während Menschen wie Mandisa bei der Arbeit schwitzten. Sie nimmt es der kinderlosen Nachbarin sehr übel, als diese die Unruhen als verrückte Taten von Schulkindern bezeichnet; wer noch nie ein Kind aufgezogen hat, solle nicht über die Kinder anderer richten. Doch Mandisas Wunsch, alle drei Kinder zu Hause zu sehen, geht nicht in Erfüllung. Sie muss zur Kenntnis nehmen, das eine weiße Frau ermordet wurde; dass die Polizei Gugulethu aufsuchen wird, die nie etwas anderes als Unterdrückung und Gewalt ins Township gebracht hat.
Magona informiert in einer Rückblende über die schrecklichen Umstände der gewaltsame Umsiedlung der schwarzen Bevölkerung in Mandisas Kindheit. Sie schildert die damit einhergehende, bedrückende Verschlechterung der Wohn- und Lebensbedingungen. Sie beschreibt Mxolisis mangelnde Bildungschancen als direkte Folge dieser Umsiedlung.
Das kurze Kapitel ist der Polizei gewidmet, die Mandisas Wohnung um 4 Uhr in der Nacht überfällt. Die Polizei hat schon Menschen und Kinder in Gugulethu getötet; jetzt wird Mandisas Wohnung komplett zertrümmert, das Hokkie der Kinder (Wellblechschuppen, überbliebene Erstbehausung der Zwangsmigration) abgerissen, der jüngere Sohn Lunga zusammengeschlagen.
Mandisa berichtet über ihr Leben in der Jungend und ihre Eltern, die so große Hoffnungen in eine gute Ausbildung für ihre kluge Tochter gelegt hatten. Sie erzählt uns, wie Schwangerschaft und Geburt ihres ältestes Sohnes Mxolisi (der von Anfang an nichts als Ärger gemacht hat), unheilvoll in ihr Leben einbrach.
Mandisa war fünfzehn, als sie schwanger wurde. Die Warnung ihrer Mutter, sie „werde einen dicken Bauch bekommen“, wenn sie Jungen in ihre Nähe ließe, war ihre Aufklärung ; wöchentliche Kontrollen des Jungfernhäutchens sollten Mandisa schützen. Mandisa Welt war damals schon „aus den Fugen“; sie hatte gerade vom deprimierenden Schicksal und Tod ihrer Kindheitsfreunde erfahren, als sie den späteren Vater von Mxolisi traf (der ihr „schön wie ein Frühlingswetter“ erschien). Lange hatten sie in beiderseitigem Einverständnis Spiel-Sex ohne Penetration, der leider dennoch unerwünschte Folgen zeigte: Als Mandisas Mutter die vermeintliche Schwangerschaftsverhinderung immer übergriffiger betreibt und Mandisa schließlich sogar zu der ihr völlig unbekannten Großmutter ausquartiert, war Mandisa bereits (jungfräulich) schwanger.
Sie kann nur wählen zwischen einer hochriskanten, illegalen Abtreibung, an der gerade eine ihrer Freundinnen gestorben ist, oder der Heirat inklusive Leben bei der Familie des Vaters (dem Ende ihrer Träume von einer guten Ausbildung). Mandisa bekam nicht die Informationen, um ihre „Petting-Schwangerschaft“ zu verhindern, sie wurde von ihrer Mutter überhaupt vollkommen im Stich gelassen.
Die von Anfang an fehlende Autonomie Mandisas setzt sich fort, in einer Rückblende zu Mandisas „Isolationshaft“ im elterlichen Haus nach Rückkehr von der Großmutter. Es folgt die vom Priester oktroyierte Heirat mit Mxolisis Vater und ein fast sklavenhaftes Leben in seinem Clan, der ihr einen neuen, spöttischen bis beleidigenden Namen gab.
Mxolisis Vater China hatte durch Leugnen der Vaterschaft schon vorher ihr Vertrauen in ihn und damit ihre Liebe zerstört, die Geburt war sehr schmerzhaft; das Aufziehen des Kindes mit dem unwilligen Ehemann zunehmend frustrierend, bis China die Familie auf Nimmerwiedersehen verlässt.
Mandisa muss die Familie nun auch verlassen und arbeitet als Hausmädchen in einem Pflegeheim für Weiße. Sie wohnt auch bald alleine und erzieht Mxolisi zu einem sprachbegabten, aufgeweckten Kind. Bis Mxolisi die beiden älteren Kinder aus der Nachbarschaft, die sich um ihn gekümmert haben, in einem Ausdruck kindlichen Spieltriebs an die Polizei „verrät“ - die daraufhin von den Polizisten gerötet werden. Mxolisi verstummt zwei Jahre lang; Mandisa hat versagt darin, ihren trotz allem geliebten Sohn durch gute Erziehung zu schützen.
Zurück in die Gegenwart, zu Mandisas Familie nach der Polizeirazzia: Eine Familie voller Angst, die durch die Razzia Antworten auf Fragen bekommen hat, die zu schrecklich waren, sie zu stellen. Die als aufdringlich statt fürsorglich empfundene Nachbarin wird rüde abgewiesen, Mandisa streitet darüber mit ihrem Mann und untersucht danach die körperlichen Schäden ihrer Kinder: Der Sohn Lunga wird die Schläge der Polizei überleben, Tochter Siziwe hat einen schweren Schock, weint und zittert ohne Unterlass.
Als sie ihre Tochter etwas beruhigt hat, wird Mandisa von Siziwes Vater und ihrem zweiten Ehemann Dwadwa zwar etwas getröstet. Er weist ihre Sorge um Mxolisi aber auch scharf und unfreundlich mit den Worten zurück, er habe ihr schon immer gesagt, dass dieser Sohn eines Tages großen Ärger machen werde.
Der Leser wird auf einen längeren Ausflug in die Geschichte Südafrikas mitgenommen, erfährt Teile „des Wissens, mit dem Mandisa geboren wurde“: Verletzung der Menschlichkeit, Ungerechtigkeit, Diebstahl des Landes, das vom Xhosa-Volk bewirtschaftet wurde, Tilgung des ganzen Volkes aus den Geschichtsbüchern und den Schulbüchern, Lügen über angebliche Unrechtstaten ihrer Vorfahren in totaler Umkehr von Ursache und Wirkung und ein unbezwingbarer Hass über diese grund- und rechtlose, seitdem mit allen Mitteln vertuschte Auslöschung eines großen Teils ihres Volkes.
Dann zwingt ihre Tochter Siziwe sie dazu, endlich Mxolisis Teilhabe an den Unruhen rund um das ermordete weiße Mädchen bewusst wahrzunehmen, worauf sich „die Welt um sie dreht“. Kurz danach fährt der Pfarrer vor, der die Jungen am Morgen zuvor von der Kirche weggeschickt hatte, um ein geheimes Treffen zwischen Mandisa und Mxolisi einzuleiten. Mandisa befragt Mxolisi und erfährt, das er einer von Hunderten war, die Steine auf Amys Auto geworfen haben. Auf die Frage, ob Mxolisi auch einer von denen war, die Amy erstochen haben, schweigt Mxolisi; am Ende des Kapitel liegen sich beider voller Angst weinend in den Armen.
Mandisa spricht Amys Mutter an, reflektiert über Schuld und Schande von Personen und Gesellschaft und der vernichtenden Rolle, die Schande und Schuld künftig in ihren Leben und dem Leben ihrer ganzen Familie spielen würde.
Sie weist auf den Anteil der Apartheids-Gesellschaft an Mxolisis Wut und Schuld hin: Er sei ein Produkt seiner Umgebung; von Erwachsenen zum Helden erzogen, die es hätten besser wissen müssen. Sie weist auch auf ihr eigenes Leid hin, auf ihre Scham und ihre Wut. Sie weiß nicht, wie sie mit der Tat ihres Sohnes fertig werden soll, wird aber in Zukunft in ihrer Gemeinschaft wie eine Aussätzige leben. Sie versichert Amys Mutter, dass sie ihre Trauer um ihre Tochter spüren könne, weist aber auch noch einmal auf Amys Schuld hin: Sie hätte den Machtlosen in ihrem eigenem Land helfen können, sie hätte zumindest ein wenig Angst haben sollen.
Das Kapitel endet mit dem Besuch der Nachbarn, die mit Mandisa trauern und ihr helfen, mit ihrer Scham umzugehen.
Im letzten Kapitel des Romans hält Mandisa einen (kursiv gedruckten) Monolog über die verlorene Zukunft ihres Sohnes - eine aussichtslose Zukunft, wie er sie bereits seit seiner Geburt vor sich hatte, weil er in der durch die Apartheid geschaffene Hölle von vornherein zum Scheitern verurteilt war.
Danach beschreibt Mandisa noch einmal ganz genau den Mord, der ihre Rede an die fremde Mutter, ihre Erinnerungen und Gedanken, Klagen und Bitten so in seinen unerbittlichen Rahmen nimmt.
Magona versucht, in ihrem Roman Verständnis für die Gewalt und den Mord an Amy Biehl hervorzurufen, indem sie die Wahrheiten des schrecklichen Apartheidsystems beschreibt; die brutalen Einzelheiten der grundlosen Unterdrückung von Menschen, die durch komplette Verdrehung von Recht und Unrecht sinnlose Gewalt zwischen Unterdrückern und Unterdrückten erzeugt (erzeugen muss). Sie tut das von außen, in Vertretung der Opfer, die vor einer solchen Beschreibung oft zurückschrecken, weil diese ihnen erst so richtig bewusst machen würde, in welch aussichtsloser Unrechtslage sie sich befinden.
Die realen Begebenheiten beweisen, dass Magona recht hat mit ihrer Empfindung, dass diese Wahrheit die ersten Schritte zur einem Weg der Heilung ebnet: Wegen des Mordes an Amy Biehl wurden vier schwarze Männer angeklagt, die 1998 (als auch der Roman „Mother to Mother“ in der Öffentlichkeit vorgestellt wurde), von der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission begnad
Carter Cruise hart anal geknallt
Casting mit Konkurrenz zwischen Newcomern und Milfs
Piecingschlampe beim geilen Kostümdreier geknallt