Man muss nicht mal ins Wasser hüpfen
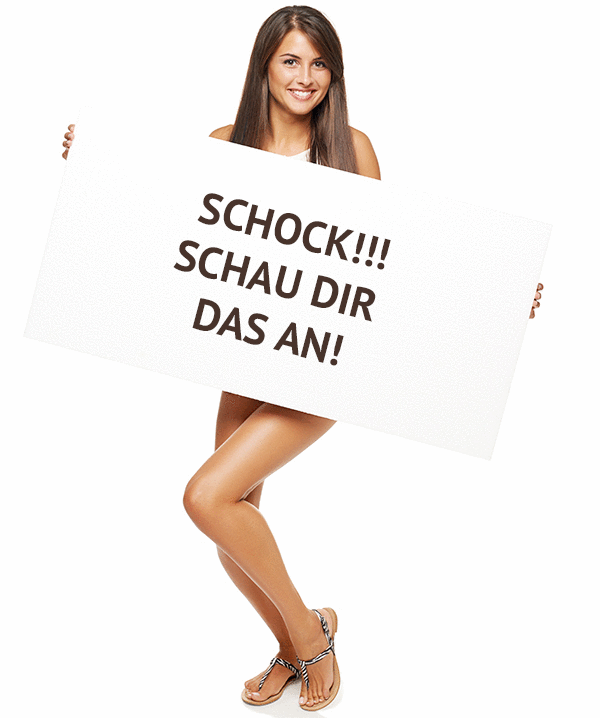
⚡ ALLE INFORMATIONEN KLICKEN HIER 👈🏻👈🏻👈🏻
Man muss nicht mal ins Wasser hüpfen
Keine lässt die Steine besser übers Wasser hüpfen: Die Weltrekordhalterin ist Favoritin in Ermatingen
Martina Eggenberger
27.06.2019, 04.30 Uhr
Nina Luginbühl, 23, Weltrekordhalterin. (Bild: Reto Martin)
Margrith Pfister-Kübler 29.06.2015
GLP-Nationalrat Martin Bäumle gilt als der beste Ukraine-Kenner im Schweizer Parlament. Er hat aber auch Kontakte nach Russland. Im Interview zeigt er einen möglichen Ausweg aus dem Krieg auf.
Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet.
Am Sonntag finden am Untersee die Schweizer Meisterschaften im Steineschiefern statt. Weltrekordhalterin Nina Luginbühl geht bei den Frauen als absolute Favoritin an den Start.
Die 23-jährige Thurgauerin Nina Luginbühl ist Weltmeisterin und Weltrekordhalterin. Keine kann besser Steine schiefern als sie. In Ermatingen hat sie letztes Mal eine Weite von 74 Metern erreicht – mit 24 Hüpfern.
Mit welchem Ziel nehmen Sie an den diesjährigen Schweizer Meisterschaften teil?
Ich möchte gewinnen. Eine spezielle Weite habe ich mir nicht vorgenommen. Es kommt immer auf das Wetter an, was drin liegt.
Was denken Sie, wie weit sind Sie der Konkurrenz voraus?
Die nächstbesten Schweizer Frauen werfen ungefähr halb so weit wie ich. Vielleicht kann ich noch ein, zwei Bekannte, von denen ich weiss, dass sie auch weit werfen, zur Teilnahme motivieren.
Wie ist das eigentlich beim Steineschiefern? Wie zählen Weite und Hüpfer?
Beim Weltrekord geht es rein um die Weite. Ein Wurf ist gültig, wenn der Stein dreimal hüpft. Bei den Schweizer Meisterschaften zählen auch die Hüpfer. Aber auch hier ist die Weite wichtiger.
Ist der Untersee geeignet, um gute Weiten zu erreichen?
Ja, sehr. Hier habe ich den Weltrekord von 74 Metern erreicht. In Wales kam ich letzten Sommer nur auf 54 Meter. Immerhin hat das dann doch noch für den Guiness World Record gereicht.
Nein, überhaupt nicht! Ich nehme das Ganze auch nicht so ernst. Trotzdem: Im Wettkampf gebe ich dann schon alles.
Ich spiele ja leidenschaftlich Kanu-Polo. Von dieser Sportart habe ich die Kraft und die Technik. Das hilft mir auch beim Steine schiefern.
Mit den perfekt flachen gegossenen Steinen kommt man am weitsten. Diese verwenden wir auch in Ermatingen. Bei der WM in Wales hatte ich die nicht dabei und musste mir vor Ort Steine suchen. Ich habe dann nicht die optimalen gefunden.
Ihre ganze Familie ist vom Sport angefressen. Bruder Thierry hat letztes Jahr gewonnen, Vater Peter war auch schon Sieger. Wer macht dieses Jahr mit?
Thierry kann leider nicht. Meine Mutter Doris hatte vor kurzem eine Operation, deshalb ist ihre Teilnahme ebenfalls unsicher. Aber mein Vater ist auf jeden Fall dabei.
Ihre Familie wurde letzten Sommer in der Sendung «SRF bi de Lüt» porträtiert. Wurden Sie oft darauf angesprochen?
Schon, ich wurde ab und zu erkannt und natürlich haben die meisten Verwandten und Bekannten die Sendung geschaut.
Sie sagen, ihre Familie habe schon immer geschiefert. Wie muss man sich das vorstellen?
Wir waren halt oft am Wasser, an der Thur. Und ich wollte mit meinem Vater und meinem Bruder mitziehen können.
Wie reagieren denn die Menschen, wenn sie von ihrem speziellen Hobby erfahren?
Die meisten finden es cool. Viele staunen einfach, was da möglich ist. Sie wissen gar nicht, dass es das Steineschiefern als Sport überhaupt gibt.
Wenn Sie die Schweizer Meisterschaften wieder gewinnen, dürfen Sie erneut an die WM. Würden Sie nach Schottland fahren?
Nein, das geht nicht. Ich beginne in wenigen Tagen eine Ausbildung in Basel und habe keine Zeit.
Die 6. Schweizer Meisterschaft im Steineschiefern findet am Sonntag, 30. Juni in der Badi Ermatingen statt. Mit am Start werden auch Cracks aus Wales und Holland sein. Das Training beginnt um 14.30 Uhr. Der Wettkampf beginnt um 16 Uhr. Mitmachen kann jedermann.
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
– Friedrich Ludwig Jahn/ Ernst Eiselen : Die deutsche Turnkunst [1]
Dieser Artikel wurde am 23. Oktober 2005 in dieser Version in die Liste der lesenswerten Artikel aufgenommen.
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; Informationen zu den Urhebern und zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können im Regelfall durch Anklicken dieser abgerufen werden. Möglicherweise unterliegen die Inhalte jeweils zusätzlichen Bedingungen. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie einverstanden.
Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foundation Inc.
Schewa Kehilot – שבע קהילות
Die jüdischen Sieben-Gemeinden unter den Fürsten Esterházy (1612–1848)
GLAMdigital zu Besuch bei den Sammlungen der Privatstiftung Esterházy. 13. Juni 2022
Das Steinehüpfen (für andere Bezeichnungen siehe den Abschnitt zu Synonymen ) ist ein Zeitvertreib, bei dem es gilt, einen flachen Stein so zu schleudern, dass er möglichst oft über eine Wasseroberfläche springt, bevor er versinkt.
Es gibt zahlreiche umgangssprachliche bzw. regionale Bezeichnungen dafür, Steine über das Wasser hüpfen zu lassen. Bereits Friedrich Ludwig Jahn zählte 1816 eine Reihe von Synonymen auf:
„In allen Wassergegenden ist das Schirken eine Belustigung der Knaben, und hat nach den einzelnen Mundarten in Landschaften und Gauen verschiedene Namen: bämmeln, das Bäuerlein lösen, bleiern, die Braut führen, Brot schneiden, Butterbämmen streichen, Butterbrot schmieren, ~ werfen, Butterstollen werfen, fischeln, flacheln, Flätter – auch Pflätter – werfen, flötzen, flözern, Frösche werfen, hitzerlen, Jungfern schießen, ~ werfen[,] – eine ein- zwei- oder dreibeinige Jungfer, Kindli werfen, die liebe Frau lösen, pfleizern, pflinzern, plätschern, plätteln, putjen, Schiffchen machen[,] ~ schlagen, schiffeln, schippern, Schneller schlagen, schnellern, Schüsselchen werfen, spätzeln, Staaren stechen, Steinblitzer machen, steineln, stelzeln, Suppen schlagen[,] ~ schmeißen[,] ~schmelzen.“
Etwa drei Jahrzehnte zuvor sieht ein anonymer Autor Butterstullenwerfen als den „gewöhnlichen“ Ausdruck an und weist noch auf das Synonym Froscherlösen hin. [2] Hermann Wagners Spielbuch für Knaben (1864) spricht nur von Steinwerfen . [3] Die Bezeichnung die Braut führen ist bereits 1616 belegt. [4]
Andere Synonyme oder lautliche Varianten zu den im Zitat von Jahn/Eiselen genannten Bezeichnungen sind Ditschen , Schnellen/Schnellern [5] (in der Bedeutung „sich mit Federkraft schnell fortbewegen“), [6] Pfitscheln , Flitschen , [7] Fitscheln [8] (Sachsen, Thüringen), im Österreichischen Flacherln oder Blattln – Vorarlberg "Flitscha" "Plätala", im Schweizerdeutschen Schiferen [9] oder auch Bämmelen . [10]
In der römischen Kaiserzeit beschrieb Minucius Felix in seinem Dialog Octavius , wie Kinder dieses Spiel am Strand spielen. [11] Auch Julius Pollux dokumentiert das Spiel in seinem Onomastikon . [12]
1585 erwähnt John Higgins in seiner Übersetzung des Lexikons Nomenclator von Hadrianus Junius , dass neben Steinen auch Austernschalen verwendet wurden. [13]
Eskimos und die Beduinen kennen das Spiel auch und benutzen Eis bzw. Sand als Untergrund.
Weltrekordhalter im Guinness-Buch der Rekorde ist seit September 2013 Kurt Steiner mit 88 Sprüngen, [14] wobei er eine Distanz von fast 100 Metern überbrückte. [15]
Zur perfekten Ausführung des Steinehüpfens sind einige physikalische Bedingungen zu erfüllen. Der Stein muss die Form eines flachen Ellipsoids oder einer Scheibe haben und so geworfen werden, dass die abgeflachte Seite und die Wasseroberfläche einen Winkel zwischen 0° und 45° bilden. Die Abwurfhöhe sollte so tief wie möglich sein, am besten nicht viel höher als die Wasseroberfläche selbst. Notwendig ist auch ein wellenarmes, ruhiges Gewässer sowie möglichst wenig Seitenwind. Außerdem muss der Stein in Rotation um seine lotrechte Achse versetzt werden. Von Kreiseln ist dieses Verhalten bekannt: Solange kein die Bewegung störendes Drehmoment auf den Körper wirkt, bleibt die Rotation unverändert erhalten und stabilisiert den Flugkörper. Wirft man Steine ohne diesen zusätzlichen Drehimpuls , so verlieren sie durch kleine Störungen während des Fluges ihre Ausrichtung. Beim Aufprall auf das Wasser tauchen sie dann unter. Eine Eigendrehbewegung des Steins ist dadurch erreichbar, indem der Stein zwischen Daumen und Mittelfinger festgehalten und im Augenblick des Abwurfs mit dem Zeigefinger auf den Rand des Steines Druck ausgeübt wird. Größere Steine hält man zwischen Daumen und Mittelfinger und legt den Zeigefinger auf der Schmalseite an, wo er beim Abwurf durch tangentiale Kraftwirkung die Rotation erzeugt.
Sobald der Stein auf die Wasseroberfläche aufprallt, springt er allerdings nicht, wie zunächst anzunehmen wäre, wie ein Ball zurück, denn die Wasseroberfläche wirkt nicht wie ein fester Körper. Gerade deshalb ist es erstaunlich, dass ein Stein überhaupt auf Wasser springen kann. Filmaufnahmen zeigen, dass der im spitzen Winkel zur Wasseroberfläche geworfene Stein mit seiner hinteren Kante zuerst auf das Wasser trifft. Der Stein gleitet dann, durch seine Drehbewegung stabilisiert, zunächst ein kleines Stück auf der Wasseroberfläche und schiebt dabei einen kleinen Wasserwall wie eine Bugwelle vor sich her, die er, bei ausreichender Geschwindigkeit , einholt: Wie an einer Sprungschanze gleitet er an dieser Welle hoch und geht in den nächsten Sprung über. Durch Reibungsverluste verliert er bei jedem Kontakt mit der Wasseroberfläche Bewegungs- und Drehenergie. Die Sprünge werden dadurch zunehmend kürzer und gehen dann in eine Art Schlittern über. Schließlich ist entweder die Geschwindigkeit des Steins so gering, dass er die Bugwelle nicht mehr einholen kann und im Wasser versinkt, oder sein Drall reicht – dies ist vor allem bei kleinen Steinen der Fall – zur Stabilisierung seiner Bahn nicht mehr aus. Der Stein trifft dann nicht mehr flach auf das Wasser und taucht ein.
Im Zweiten Weltkrieg wurden Rollbomben beim Edersee und der Möhnetalsperre im Rahmen der Operation Chastise eingesetzt, um deutsche Staumauern zu zerstören. Diese Bomben wurden in Rotation versetzt und im schnellen Tiefflug aus dem Flugzeug abgeworfen. Dadurch prallten sie – analog zu den Steinen beim Steinehüpfen – mehrmals von der Wasseroberfläche ab. So konnten die im Wasser befindlichen Abwehrnetze umgangen werden, die den Einsatz von Torpedos verhindern sollten.
Die Forscher Lionel Rosellini, Christophe Clanet, Fabien Hersen und Lydéric Bocquet der Universitäten Marseille und Lyon haben die Bedingungen für den optimalen Steinwurf experimentell untersucht. Sie konstruierten eine Wurfmaschine, die Aluminiumscheiben als flache Modellsteine auf eine Wasseroberfläche schleuderte. Bei den Würfen variierten die Wissenschaftler die Abwurfgeschwindigkeit des Steins, seinen Aufprallwinkel auf dem Wasser sowie die Eigenrotation der Scheibe. Der Bewegungsablauf wurde mit einer Hochgeschwindigkeitskamera dokumentiert. Bei der Auswertung der Daten kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass kurze Kontaktzeiten mit der Wasseroberfläche die Anzahl der möglichen Sprünge entscheidend beeinflussen: Je kürzer der Kontakt, desto weniger Energie geht durch Reibung verloren. Im Experiment betrug diese Zeit weniger als 10 ms. Die Energieverluste sind auch der Grund, warum Steine mit kleinen Anfangsgeschwindigkeiten wenig erfolgreich sind. Unabhängig von der Eigenrotation oder der Geschwindigkeit des Steins wurde die optimale Berührungszeit dann erreicht, wenn der Stein in einem Winkel von 20° auf die Wasseroberfläche prallte. Bei Aufprallwinkeln über 45° konnte das Sprungphänomen überhaupt nicht mehr beobachtet werden.
Auch auf feuchtem Sand lassen sich Steinsprünge ausführen. Dabei kann beobachtet werden, dass kurze und lange Sprungweiten einander abwechseln. Filmaufnahmen zeigen, dass die kurzen Abstände entstehen, wenn die hintere und vordere Kante des Steins auf den im Vergleich zum Wasser festeren Sand treffen. Der Stein wird durch den Aufprall so abgebremst, dass er kippt, bevor er erneut zum Sprung ansetzt.
Der Hüpf-Effekt der Steine wird auch als Erklärung für das „Abprallen“ eines Raumfahrzeugs beim zu flachen Wiedereintritt in die Erdatmosphäre genommen. Dies ist jedoch falsch, übliche Wiedereintrittskörper erzeugen dafür zu wenig Auftrieb. Das vermeintliche „Abprallen“ ist ein geometrischer Effekt: Durch zu geringes Abbremsen bleibt die Bahn näherungsweise eine Ellipse, auf der sich der Körper zuerst dem Planeten nähert (siehe Erdnähe oder Perigäum ) und später wieder entfernt. Wenn diese Bahn als Höhe über der Planetenoberfläche interpretiert wird, ergibt sich anfangs ein Absinken und später wieder ein Ansteigen. Auch ein mehrfaches Eintauchen in die Atmosphäre bei einer Atmosphärenbremsung zeigt bei einer einfachen Auftragung der Bahnhöhe ein ähnliches Bild wie der hüpfende Stein, hat jedoch eine ganz andere Ursache. Hypothetische Raumgleiter mit einem wesentlich stärkeren Auftrieb wie der Silbervogel oder der Waverider würden ein Hüpfen ähnlich dem Stein in der Hochatmosphäre möglich machen.
Dieser Artikel ist als Audiodatei verfügbar:
bildderfrau.de, derwesten.de, donna-magazin.de, hoerzu.de, klack.de, futurezone.de, gong.de, moin.de, myself.de, news38.de, thueringen24.de, tvdigital.de, tvdirekt.de, tvfuermich.de, werstreamt.es, wmn.de
Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen
Für die Ihnen angezeigten Verarbeitungszwecke können Cookies, Geräte-Kennungen oder andere Informationen auf Ihrem Gerät gespeichert oder abgerufen werden.
Anzeigen können Ihnen basierend auf den Inhalten, die Sie ansehen, der Anwendung, die Sie verwenden und Ihrem ungefähren Standort oder Ihrem Gerätetyp eingeblendet werden.
Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen
Über Sie und Ihre Interessen kann ein Profil erstellt werden, um Ihnen für Sie relevante personalisierte Anzeigen einzublenden.
Personalisierte Anzeigen können Ihnen basierend auf einem über Sie erstellten Profil eingeblendet werden.
Ein personalisiertes Inhalts-Profil erstellen
Über Sie und Ihre Interessen kann ein Profil erstellt werden, um Ihnen für Sie relevante personalisierte Inhalte anzuzeigen.
Personalisierte Inhalte können Ihnen basierend auf einem über Sie erstellten Profil angezeigt werden.
Die Leistung und Wirksamkeit von Anzeigen, die Sie sehen oder mit denen Sie interagieren, kann gemessen werden.
Die Leistung und Wirksamkeit von Inhalten, die Sie sehen oder mit denen Sie interagieren, kann gemessen werden.
Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen
Marktforschung kann verwendet werden, um mehr über die Zielgruppen zu erfahren, die Dienste oder Anwendungen verwenden und sich Anzeigen ansehen.
Ihre Daten können verwendet werden, um bestehende Systeme und Software zu verbessern und neue Produkte zu entwickeln.
Ihre genauen Standortdaten können für einen oder mehrere Verarbeitungszwecke genutzt werden. Das bedeutet, dass Ihr Standort bis auf wenige Meter präzise bestimmt werden kann
Geräteeigenschaften zur Identifikation aktiv abfragen
Ihr Gerät kann über eine Abfrage seiner spezifischen Merkmale erkannt werden.
Home
Essen
Duisburg
Bochum
Mehr Städte
Dortmund
Gelsenkirchen
Mülheim
Oberhausen
Auf Kohle geboren
Zur Revier-Übersicht
1. Bundesliga
BVB
S04
Sport
Fußball
S04
BVB
Sport-Mix
News
Promi & TV
Vermischtes
Politik
Wirtschaft
Reise
Shopping
Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.
Home
Essen
Duisburg
Bochum
Mehr Städte
Dortmund
Gelsenkirchen
Mülheim
Oberhausen
Auf Kohle geboren
Zur Revier-Übersicht
1. Bundesliga
BVB
S04
Sport
Fußball
S04
BVB
Sport-Mix
News
Promi & TV
Vermischtes
Politik
Wirtschaft
Reise
Shopping
Home
–
Gesundheit
–
Hüpfen oder abdichten? Tipps gegen Schwimmbad-Wasser im Ohr
Hüpfen oder abdichten? Tipps gegen Schwimmbad-Wasser im Ohr
Gegen Wasser im Ohr hilft nicht nur Hüpfen, sondern auch der Einsatz von Kunststoffohrstöpseln.
Wasser im Ohr kann beim Schwimmen unangenehm sein. Meist ist es harmlos – aber Menschen mit empflindlichen Ohren sollten lieber auspassen.
Hier geht's zu unseren Zeitungsportalen:
Unsere weiteren News-Portale:
Eine Seite der
FUNKE
Mediengruppe – powered by FUNKE Digital
Mainz. Beim Schwimmen gerät schnell mal Wasser ins Ohr. In der Regel helfe es, das Wasser einfach rauszuschütteln, sagt Marianne Frickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker (Biha). Sie empfiehlt, den Kopf schräg zu halten und zu schütteln, damit die Flüssigkeit hinauslaufen kann, und gegebenenfalls etwas auf der Stelle zu hüpfen.
"Es kann ein paar Stunden dauern, bis das Wasser raus ist", sagte sie dem dpa-Themendienst. Manchmal sei das erst in der Nacht der Fall, wenn der Betroffene auf dem Ohr liegt. Dass es manchmal etwas dauert, hängt damit zusammen, dass der etwa 2,5 Zentimeter breite Gehörgang zwei Windungen hat, die das hereingeflossene Wasser auch auf seinem Weg zurück wieder passieren muss.
Um von vornherein zu vermeiden, dass Wasser ins Ohr kommt, bietet sich ein Schwimmschutz an, der den Gehörgang nach außen abdichtet. Allerdings ist nicht jeder Ohrstöpsel geeignet, betont Frickel: Schaumstoffstöpsel etwa saugen sich beim Schwimmen voll. Besser sind daher allergiegetestete Exemplare aus Silikon. Diese gibt es als Standard-Modelle fertig zu kaufen. "Für mal Schwimmen gehen ist das ausreichend", erläutert die Biha-Präsidentin. "Allerdings erreiche ich damit nie die optimale Abdichtung."
Wer regelmäßig Schwimmen geht, ist daher womöglich mit individuell angefertigten Stöpseln besser beraten, wie sie auch Schwimmprofis verwenden. Denn jedes Ohr ist etwas unterschiedlich geformt. "Diese Stöpsel sind in der Anschaffung etwas teurer, aber so lange brauchbar, bis sich das Ohr zum Be
Hübsche Brünette bekommt es in den Hintern
Carissa Wird Geknallt - Pornhub Deutsch
Ficken mit ihr und ihrer Freundin