Katsuni nach Boxtraining in die Zange genommen
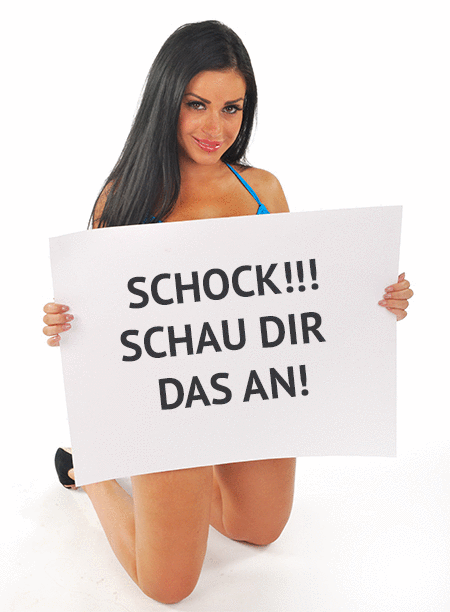
⚡ ALLE INFORMATIONEN KLICKEN HIER 👈🏻👈🏻👈🏻
Katsuni nach Boxtraining in die Zange genommen
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie auf Ihre Interessen abgestimmte Inhalte sowie unsere vielseitigen Newsletter.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie auf Ihre Interessen abgestimmte Inhalte sowie unsere vielseitigen Newsletter.
Jetzt Mitglied werden! Erleben Sie WELT so nah wie noch nie.
Home Welt Print In die Zange genommen
Veröffentlicht am 17.07.2007 | Lesedauer: 6 Minuten
Von Jan Hildebrand; Gesche Wüpper; Matthias Iken
Die Machtbalance bei EADS wird neu austariert. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Beste aus einer verfahrenen Situation herausgeholt: In die Zange genommen
WIR IM NETZ Facebook Twitter Instagram UNSERE APPS WELT News WELT Edition
E s sah nicht gerade nach einem freundlichen Empfang für Angela Merkel aus. Bevor die Bundeskanzlerin in Toulouse landete, stieg dichter Rauch hinter einer Airbus-Lagerhalle auf dem Flughafen auf. Bei einem A340 hatte es eine Ölverpuffung gegeben. Zudem drohte der rote Teppich wegzuwehen. Helfer klebten ihn auf dem Beton fest. Die Ehrengarde wechselte kurz vor Merkels Landung die Seite, um der Kanzlerin Windschutz zu bieten.
Gemessen an den widrigen Umständen, ging der Empfang dann reibungslos über die Bühne. Die Szenerie aber hatte etwas Symbolhaftes. Auch Merkel konnte bei ihrem Besuch in Toulouse nur das Beste aus einer verfahrenen Situation machen. Sie war angereist, um sich mit dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy auf eine neue Führungsstruktur bei der Airbus-Mutter EADS zu verständigen. Heraus kam ein Kompromiss, der die deutsche Position im Luft- und Raumfahrtkonzern nicht zurückwirft - aber auch nicht stärkt.
Merkel, Sarkozy und die beiden privaten Großaktionäre DaimlerChrysler und Lagardère einigten sich drauf, die Doppelspitzen abzuschaffen. Den Verwaltungsrat soll künftig der Deutsche Rüdiger Grube leiten. Der Franzose Louis Gallois wird alleiniger EADS-Chef. Sein bisher gleichberechtigter Kollege Thomas Enders wird CEO bei der wichtigsten EADS-Tochter Airbus. Enders zeigte sich sichtlich entspannt. "Es gibt nur einen Sieger: Das ist die Firma", sagte er. "Die Entscheidung, die Doppelspitze abzuschaffen, bedeutet einen großen Schritt nach vorne und wird jetzt für mehr Ruhe im Unternehmen sorgen."
Zusammen mit Gallois wartete Enders vor dem firmeneigenen Airbus-Flug-Terminal in Toulouse auf Sarkozy und Merkel. Während Gallois lächelnd auf die spätere Ankündigung verwies, gab sich Enders auskunftsfreudig. Er habe viele Jahre lang das Rüstungsgeschäft von EADS geleitet, deshalb sei Airbus für ihn die letzte operative Herausforderung im Konzern. Airbus - und die Umsetzung des milliardenschweren Sparprogramms Power 8 - sei entscheidend für die Zukunft von EADS.
Die Stoßrichtung der Aussage ist klar: Mit Airbus hat Enders die wichtigste EADS-Tochter - sie steuert zwei Drittel des Konzernumsatzes bei - unter Kontrolle. Eine mächtige Position, wie auch Peter Hintze betont. Der CDU-Politiker ist Koordinator der Bundesregierung für Luftfahrt und feiert den Kompromiss als Erfolg. "Wir können mit unserem Einfluss sehr zufrieden sein", sagt er. Mit den Chefposten im Aufsichtsrat und bei Airbus habe man zwei strategisch wichtige Positionen besetzt.
Das stimmt - aber nur auf den ersten Blick. Denn die EADS-Aktionäre haben ein Rotationsprinzip installiert. "In fünf Jahren wird es einen französischen Aufsichtsratschef geben", betonte Sarkozy. Und noch ein zweiter Aspekt war dem Präsidenten wichtig: "Airbus wird von Herrn Enders geleitet werden, zusammen mit Herrn Brégier als Nummer Zwei." Dem Deutschen wird also ein Franzose zur Seite gestellt. Und über Enders thront Gallois.
Die Ausgangslage war für die Bundesregierung von Anfang an schwierig: Die Deutschen hätten auf den EADS-Chefposten für Enders pochen können. Doch dann hätte dieser in einer französischen Zange zwischen einem möglichen Airbus-Chef Brégier und einem Aufseher Gallois gesessen. Die einzige Alternative: die jetzt gefundene Lösung. Die sieht die Bundesregierung als einen "Hauch besser" an, wie es in Verhandlungskreisen heißt.
Offiziell wollte gestern niemand etwas von deutschen oder französischen Zangen wissen. Merkel und Sarkozy feierten ihre Einigung. Nach einem Mittagessen in der Airbus-Kantine besichtigten die beiden eine Montagehalle. Vor der roten Nase des Großflugzeugs A380 verkündeten sie Hunderten Airbus-Mitarbeitern ihre frohe Botschaft. "Das ist ein großer Tag für die deutsch-französische Achse", rief Sarkozy. EADS werde gestärkt für den Wettbewerb mit Boeing. Merkel stimmte in die Lobeshymnen ein: "Es ist für mich ein sehr bewegender Moment, hier zu sein. Die Leute mit denen ich hier gesprochen habe, haben mir gezeigt, dass hier die deutsch-französische Freundschaft gelebt wird ", sagte sie unter tosendem Beifall der Belegschaft.
Auch im deutschen Airbus-Werk in Hamburg war die Stimmung nach Verkündung des Personaltableaus gut. "Es ist positiv, dass wir nach Monaten der Ungewissheit klare Strukturen haben", sagte Airbus-Deutschland-Chef Gerhard Puttfarcken der WELT. "Das steigert die Effizienz des Unternehmens." Begeistert kommentierte Wirtschaftssenator Gunnar Uldall (CDU) die Entscheidung: "Von allen personalpolitischen Konstellationen, die in den vergangenen Wochen diskutiert wurden, ist das die für Hamburg positivste."
Die Politik verspricht sich viel von ihrem guten Draht zu dem künftigen Airbus-Chef Enders. Der hatte sich bereits in der Vergangenheit für deutsche Standorte stark gemacht. Und der Aufsichtsratschef Grube sei wenige Kilometer vom Hamburger Airbuswerk aufgewachsen, frohlockte Uldall. "Er hat ein besonderes Herz für Hamburg."
Auch die deutschen Arbeitnehmervertreter sind deshalb glücklich über die Personalie. "Mich hat schon vieles überrascht, aber diese Meldung stellt alles in den Schatten", sagte Hamburgs Betriebsratschef Horst Niehus. "Wir haben die Hoffnung, dass es nun voran geht und das Elend der vergangenen Monate ein Ende hat."
Wie lange die gute Laune in den Werkshallen anhält, ist jedoch ungewiss. Die große Bewährungsprobe steht dem Unternehmen und der neuen Führung bei der Durchsetzung des Sparprogramms Power 8 bevor. Und hinter dem steht die alte Doppelspitze weiter, wie Gallois betonte. Er und Enders hatten beschlossen, 10 000 Stellen zu streichen und zahlreiche Werke zu verkaufen. Bis zum 27. Juli sollen sich interessierte Investoren bei Airbus melden, sagte Gallois.
Dann beginnt die wirklich spannende Phase der Sanierung. Über keine Frage verkrachten sich Deutschland und Frankreich in der EADS-Geschichte so häufig wie Standortfragen.
Auf Sarkozy und Merkel wartet zudem noch ein anderes Thema, das Sprengkraft birgt. Der französische Präsident lässt keine Gelegenheit aus, zu erklären, dass er für sein Land mehr Einfluss im Aktionärskreis wünscht. Die Bundeskanzlerin machte hingegen vor ihrem Flug nach Toulouse deutlich, dass der Staatseinfluss bei EADS eher reduziert als erhöht werden solle.
Wer genau hinhörte, konnte gestern bereits Dissonanzen feststellen. Merkel betonte, dass die Frage eine Kapitalerhöhung keine Rolle gespielt habe. "Das Problem steht aktuell nicht auf der Tagesordnung, aber vielleicht in zwei, drei Jahren." Sarkozy scheint ein anderer Zeithorizont vorzuschweben: In zwei oder drei Monaten würde man noch einmal über die Aktionärsstruktur reden, kündigte er an. "Die Tatsache, dass unsere deutschen Freunde bereit sind, über den Aktionärspakt zu reden, ist genau das, was wir uns gewünscht haben."
Um die Harmonie des Gipfels nicht zu stören, schoben Merkel und Sarkozy das Streitthema flugs ab. Eine Arbeitsgruppe soll bis Ende des Jahres Vorschläge erarbeiten. Wie die Unterhändler die unterschiedlichen Vorstellungen Deutschlands und Frankreichs zur Industriepolitik zusammen bringen sollen, blieb offen.
Das bleibt ein Thema für den nächsten deutsch-französischen Gipfel, zu dem sich Sarkozy selbst einlud: "Ich möchte Angela Merkel danken, dass sie diese Einladung akzeptiert hat", sagt er. "Ich werde im Gegenzug nach Hamburg kommen." Man darf gespannt sein, wie herzlich der Empfang für Sarkozy ausfällt.
Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so sind Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de
Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/102869351
PNN Überregionales In die Zange genommen
Die Regierung will die Volkskrankheit Krebs bekämpfen und legt einen Gesetzentwurf vor. Wie sinnvoll sind die geplanten Veränderungen?
Bessere Datenerfassung und mehr Vorsorge: Mit diesem Doppelrezept will die Bundesregierung den Kampf gegen den Krebs forcieren. Das nun am Mittwoch vom Kabinett auf den Weg gebrachte Gesetz sieht vor, von 2016 an Versicherte persönlich zur Früherkennung von Darm- und Gebärmutterhalskrebs einzuladen. Vorbild dafür ist das bereits bestehende Programm zur Brustkrebsfrüherkennung für Frauen. Zudem werden die Bundesländer verpflichtet, ab 2018 in allen Krankenhäusern standardisierte Krebsregister zu führen. Darin sollen das Auftreten, die Behandlung und der Verlauf von Krebserkrankungen dokumentiert werden.
Bereits vor vier Jahren haben Gesundheitsministerium, Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe und die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren den Nationalen Krebsplan ins Leben gerufen. Er legt vier Handlungsfelder für die Krebsbekämpfung fest: Weiterentwicklung der Früherkennung, Verbesserung der medizinischen Versorgung und Qualitätssicherung, eine effizientere Behandlung und bessere Patienteninformation. Der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf der Bundesregierung zu Früherkennung und Krebsregistern setzt also Empfehlungen des Nationalen Krebsplans um.
Wie viele Krebserkrankungen gibt es in Deutschland?
Krebs ist hierzulande die zweithäufigste Todesursache nach den Herz-Kreislauferkrankungen, etwa jeder vierte Deutsche erliegt einem Tumorleiden. 2008 erkrankten etwa 470 000 Menschen an Krebs, 218 000 starben daran. Als Krebs bezeichnet man das ungehemmte und zerstörerische Wuchern von körpereigenem Gewebe. Die Ursachen sind hauptsächlich genetische Veränderungen, die sich mit den Lebensjahren im Erbgut der Körperzellen anhäufen – weshalb Krebs auch eine Bürde des Alters ist. Da die Lebenserwartung in Deutschland weiter steigt, ist mit einer Zunahme von Krebserkrankungen zu rechnen. Immer mehr Menschen erreichen ein Alter von 70, 80 oder mehr Jahren, in denen Krebs häufig ist. Und so steigt die Zahl der Fälle, obwohl das Risiko für den Einzelnen nicht größer geworden ist, in dieser Altersgruppe an einem Tumor zu erkranken.
Wie soll künftig die Krebsvorsorge verbessert werden?
Bei ihrem Gesetzentwurf hält sich die Bundesregierung an Leitlinien der EU- Kommission. Diese sehen vor, dass Krebsfrüherkennungsprogramme „organisiert“ ablaufen sollen. Demnach werden Angehörige bestimmter Altersgruppen regelmäßig zur Krebsvorsorge- oder Früherkennung eingeladen. Solche Reihenuntersuchungen für Gesunde nennt man auch „Screening“. Bislang gibt es ein organisiertes Screening in Deutschland nur bei der Brustkrebsfrüherkennung. Frauen zwischen 50 und 69 haben alle zwei Jahre Anspruch auf eine Röntgenaufnahme der Brust (Mammographie) zur Früherkennung, die die gesetzliche Krankenversicherung bezahlte. Nun soll auch zu Darmkrebs- und Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge eingeladen werden. Bei Darmkrebs kommen Menschen ab 50 in Frage, bei Gebärmutterhalskrebs Frauen zwischen 20 und 65. Wie das Gesetz im Detail ausgestaltet wird, etwa welche Tests eingesetzt werden und in welchen Zeitabständen zur Vorsorge eingeladen wird, darüber wird der Gemeinsame Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen befinden. Die Einladung soll die Teilnehmerzahlen erhöhen. Kritiker wie Christian Albring, Chef des Berufsverbands der Frauenärzte, weisen aber darauf hin, dass am Mammographie-Screening nur 50 bis 70 Prozent der Frauen teilnehmen und die Zahlen sogar rückläufig seien.
Unbestritten ist: Je eher ein Krebs erkannt wird, umso größer sind die Heilungschancen. Nur steckt der Teufel im Detail. Wenn bei Gesunden nach einem Tumor gesucht wird, wird nicht selten falscher Alarm ausgelöst. Das ist vor allem bei der Brustkrebs- wie bei der Prostatakrebs-Früherkennung ein Grund, dass beide Vorsorgeuntersuchungen immer noch wissenschaftlich umstritten sind.
Welchen Nutzen hat die nun geplante Vorsorge speziell bei Darmkrebs und bei Gebärmutterhalskrebs?
Schon heute haben alle Versicherten ab dem 55. Lebensjahr Anspruch auf eine Darmspiegelung alle zehn Jahre. Darmkrebs entwickelt sich meist über mehrere Jahre aus gutartigen Wucherungen (Polypen). Bei der Darmspiegelung werden diese Polypen entfernt und damit dem Krebs vorgesorgt. Der Nutzen der Darmspiegelung ist also klar belegt. In seltenen Fällen kann allerdings bei der Untersuchung mit einem dünnen Rohr die Darmwand verletzt werden und eine Infektion der Bauchhöhle entstehen.
Gebärmutterhalskrebs ist in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter zurückgedrängt worden. Das ist auch ein Verdienst der Krebsvorsorge mit Hilfe des Abstrichs vom Muttermund, dem Übergang von der Scheide zur Gebärmutter. Heute finden sich mindestens 60 Prozent der Fälle von Gebärmutterhalskrebs bei Frauen, die die letzten fünf Jahre vor der Diagnose nicht bei der Vorsorge waren. Die Einladung könnte helfen, diese Frauen zu erreichen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, diesen Frauen einen Selbsttest zuzuschicken, den sie dann bei derApotheke abgeben und auswerten lassen.
Was sagen die Kritiker der Vorsorge?
Die Aufforderungen zur Vorsorgeuntersuchung sind nicht unumstritten. Da es dadurch „regelmäßig zu Überdiagnosen und in der Folge zu unnötigen Eingriffen“ komme, sollten die Bürger nur zum ärztlichen Beratungsgespräch über Chancen und Risiken solcher Untersuchungen eingeladen werden, fordern die Grünen-Abgeordneten Maria Klein-Schmeink und Biggi Bender. Das sieht der Vize-Geschäftsführer beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen, Stefan Gronemeyer, genauso. „Ein Überreden oder Motivieren der Bevölkerung ist nicht mehr zeitgemäß“, meint er. Schließlich seien auch Vorsorgeuntersuchungen nicht risikolos und es sei „zu befürchten, dass die Anzahl der Übertherapien die Anzahl der verhinderten Krebstodesfälle übersteigt“. Die Ausweitung von Kontroll- und Früherkennungsprogrammen „sichert zwar zusätzliche Einnahmequellen für Ärzte, wird aber zur Eindämmung von Krebserkrankungen überschätzt“, glaubt die Linken-Gesundheitspolitikerin Martina Bunge.
Nach Ansicht des CDU-Gesundheitsexperten Jens Spahn dagegen sollten Versicherte für den regelmäßigen Besuch von Krebsvorsorgeuntersuchungen sogar belohnt werden. Gesundheitsminister Bahr lehnt dies aber ab. Der Einzelne müsse „frei von finanziellen Druck“ entscheiden, ob Früherkennung sinnvoll für ihn sei oder nicht, sagte er. Dazu passt, dass die bisherige Regelung gestrichen werden soll, wonach chronisch Kranke für ihre Arznei mehr zuzahlen müssen, wenn sie vor dem Ausbruch ihrer Krebserkrankung nicht regelmäßig zur Vorsorge gegangen sind.
Welchen Nutzen bringen die geplanten Krebsregister aus medizinischer und auch aus wissenschaftlicher Perspektive?
An der Idee, flächendeckende Register, aufzubauen, ist wenig zu kritisieren. Krebsforscher sind erleichtert darüber, endlich eine gesetzliche Grundlage für solche Datensammlungen zu erhalten, sie sprechen von einem Durchbruch. Und selbst die Grünen loben den FDP-Minister für seinen Vorstoß. Beanstandet wird nur die lange Frist für den Aufbau der Register – die Länder können sich bis zum Jahr 2018 Zeit lassen. Und manchen geht die Vereinheitlichung nicht weit genug. Die Ersatzkassen etwa verlangen, die Krebsregister auf eines pro Bundesland zu begrenzen. Der SPD-Experte Karl Lauterbach wiederum ärgert sich darüber, dass die Daten nur Wissenschaft und Politik, nicht aber der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollen. „Die Menschen wollen wissen: Wie hoch ist das Krebsrisiko in einer bestimmten Region – etwa in der Nähe einer Chemiefabrik?“ Und für Patienten seien auch die Behandlungserfolge oder -misserfolge der Kliniken von Interesse.
Weshalb gibt es bislang keine einheitlichen Krebsregister?
Das liegt vor allem an den Westdeutschen. In Ostdeutschland gibt es eine solche Datensammlung seit langem. Bereits 1952 begann die damalige DDR mit der systematischen Registrierung von Krebsfällen. Und nach der Wende beschlossen die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und die Freistaaten Sachsen und Thüringen, diesen Datenbestand als Gemeinsames Krebsregister weiterzuführen. Epidemiologische Register gibt es auch in westdeutschen Ländern, das älteste in Hamburg. Allerdings haben die meisten noch keine vollzählige Registrierung erreicht. Zudem fehlt es an der Verknüpfung mit klinischen Registern, bei denen es um die Krebsbehandlung geht.
Nur bei Kindern ist man weiter. Seit 1980 gibt ein bundesweites Kinderkrebsregister, das epidemiologische mit klinischen Daten kombiniert. Und seit 2006 garantiert eine Qualitätssicherungsvereinbarung, dass alle jungen Patienten bundesweit nach einheitlichen Therapieplänen behandelt werden. Aus Expertensicht ist dies der Grund für die hohe Heilungsrate von inzwischen 81 Prozent, mit der Deutschland bei krebskranken Kindern weltweit an der Spitze liegt.
Laut Gesetzentwurf wird allein der Aufbau der Krebsregister jährlich knapp 50 Millionen Euro kosten. Die Einladungskosten zu den Vorsorgeuntersuchungen summieren sich nach Ministeriumsschätzung auf 23 bis 66 Millionen Euro. Bezahlen sollen das im Wesentlichen die gesetzlichen Krankenkassen. Der Minister begründet dies damit, dass durch früh erkannte Krebserkrankungen die Versicherer jede Menge bei den Behandlungskosten einsparten. Zudem könnten sie durch „gute Verhandlungen“ ja auch Einfluss auf die Kosten der Vorsorgeuntersuchungen nehmen. Die Versicherer dagegen ärgern sich. „Wenn ganz offenbar versicherungsfremde Leistungen wie Versorgungsforschung, die Zertifizierung von wissenschaftlichen Einrichtungen oder die Ressourcenplanung der Länder mit diesen Daten gefördert werden sollen, darf das nicht allein die Beitragszahler belasten“, sagt die Chefin ihres Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer. Zur langen Vorlaufzeit für die Krebsregister sagt sie: „Da die Länder keinen finanziellen Anreiz haben, die Aufbauphase schnell zu beenden, bezahlen wir im schlimmsten Fall fünf Jahre lang für den heutigen Zustand – und der bringt ja für die bundesweite Qualitätssicherung bekanntermaßen wenig.“
Passwort vergessen/ändern?
Registrieren
Verlag Team Kontakt Mediadaten Abo Jobs
Home
A&W Pro In die Zange genommen
Glaubitz (ecu.de) bietet Elektronik-Reparaturen
Der Partner für Innovation: Lack, Zubehör, Werkstattausrüstung & Schulung
Total digital – für Werkstätten fatal?
WERKSTATT-FORUM: Geballtes Programm
FLOTTE
AUTO BILD Österreich
AUTO-Information
ALLRADKATALOG
FAMILIENAUTOS
FUHRPARK Kompakt
Nutzfahrzeug KOMPASS
automotive GUIDE
A&W-Tag
FLEET Convention
Loggen Sie sich hier ein um das gesamte A&W-Pro-Angebot zu nutzen
Bitte geben Sie im Feld Ihre E-Mail-Adresse an. Ihr Passwort wird Ihnen erneut zugeschickt.
Würth beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Design von Zangen – mit erfreulichen Ergeb
Interracial Lesben Orgie
Fettes und dünnes Teengirl haben Lesbensex
Blondine darf seinen Schwanz lutschen