In einem Schritt den Rassismus beendet
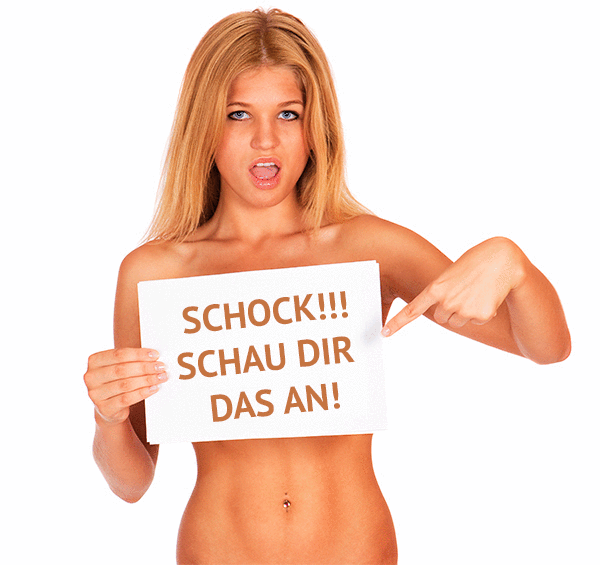
🔞 ALLE INFORMATIONEN KLICKEN HIER👈🏻👈🏻👈🏻
In einem Schritt den Rassismus beendet
| Meinung | Rassismus beenden: 5 Vorschläge gegen Diskriminierung
Fünf Vorschläge gegen Diskriminierung
Nach dem Mord an George Floyd (†46) fragen sich viele: Wie können wir People of Color unterstützen? SonntagsBlick-Reporter Fabian Eberhard hat fünf Vorschläge.
Publiziert: 06.06.2020 um 23:58 Uhr
Aktualisiert: 18.06.2020 um 21:29 Uhr
«Kartonteile sind geflogen und etwas ist explodiert»
Ex-Bachelorette-Kandidat würgt Freundin k.o.
Das steckt hinter der Favre-Absage in Gladbach
Verfolgungsjagd mit 249 km/h auf A3 bei Thalwil ZH
Zu diesen Tricks greifen Wohnungssuchende
So nähern sich Harry und William an
Russisches Staats-TV sieht Dritten Weltkrieg kommen
Bayern-Boss Kahn watscht Lewandowski ab
Einloggen und einen Kommentar schreiben...
Russisches Militär meldet grossen Leichenfund
Rocker gehen schon wieder aufeinander los
Verfolgungsjagd mit 249 km/h auf A3 bei Thalwil ZH
Blick.ch - das Schweizer News-Portal © Blick.ch 2022.
Ringier.ch - We inform. We entertain. We connect.
Einstellungen Akzeptieren und schliessen
Save and Close A reminder you can control your user privacy preferences Einstellungen zum Datenschutz anpassen
Der Mord an George Floyd (†46) bewegt die Welt. Und führt auch in der Schweiz zu einer Diskussion über Rassismus. Doch was können weisse Menschen tun, um People of Color zu unterstützen? Wie können wir ihnen beistehen? Hier fünf Vorschläge.
Um Rassismus zu bekämpfen, muss man ihn erst mal wahrnehmen. In der Schweiz ist Diskriminierung oft erst auf den zweiten Blick erkennbar. Bei institutionellen Benachteiligungen etwa, in der Schule, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt oder bei Behörden.
Weisssein ist ein Vorteil. Im Englischen gibt es dafür einen Begriff: «White Privilege» . Damit sagt niemand, dass nicht auch unser Leben schwierig ist, sondern lediglich, dass die Hautfarbe nicht zu unseren Problemen beiträgt. Das grösste weisse Privileg ist, dass wir uns nicht mit Rassismus beschäftigen müssen. Tun wir es trotzdem! Setzen wir uns mit Diskriminierung auseinander, ohne dafür Dankbarkeit zu erwarten. Dazu gehört auch, dass wir uns bewusst werden, welche zentrale Rolle die Schweiz und die Schweizer Wirtschaft zu Zeiten des Kolonialismus gespielt haben.
Rassismus erkennen heisst manchmal auch, in den Spiegel zu schauen. Selbst wenn es vielen unbewusst ist oder nicht böse gemeint: Alle haben Vorurteile. Und wir reproduzieren sie. So kränkt es etwa viele Schwarze, wenn sie gefragt werden: «Wo kommst du her? Also ich meine, wo kommst du wirklich her?» Und das, obwohl sie in der Schweiz geboren und aufgewachsen sind. Damit signalisieren wir: Du bist anders.
Hören wir zu, wenn Menschen über Diskriminierungserfahrungen berichten. Und vor allem: Nehmen wir sie ernst. Tönt selbstverständlich, ist es aber nicht. Grund ist die «White Fragility», die weisse Zerbrechlichkeit. Der Begriff meint, dass Weisse oft schon auf die Andeutung, dass ihr Weisssein Bedeutung hat, ablehnend reagieren. Besonders stark betroffen sind ausgerechnet Linke und Liberale, die denken, dass sie selbst sich ganz sicher nicht rassistisch verhalten.
Schweigen bedeutet Zustimmung. Es braucht aktive Solidarität mit von Rassismus Betroffenen. Schreiten wir ein, sobald wir Diskriminierung beobachten. Auch wenn sie beiläufig passiert. Stellen wir uns Diskussionen, auch unangenehmen. Und auch dann, wenn wir sie mit Freunden oder Familienmitgliedern führen müssen. Es reicht nicht, an der Seitenlinie zu stehen. Seien wir nicht bloss nicht rassistisch. Seien wir antirassistisch.
Wenn Sie unsere Webseiten und Applikationen benutzen, werden durch Cookies und verschiedene weitere Technologien von uns und Dritten Daten über Sie gesammelt.
Einige dieser Technologien sind notwendig, damit unsere Webseiten und Applikationen einwandfrei funktionieren. Andere wiederum sind optional und unterstützen uns dabei, unsere Produkte und Dienstleistungen stetig zu verbessern und Ihren Bedürfnissen anzupassen, Trends zu erkennen, Statistiken über die Nutzung unserer digitalen Angebote zu erstellen und auszuwerten und um Ihnen personalisierte Werbung ausspielen zu können.
Die meisten genannten Datenbearbeitungen werden auf der Grundlage von berechtigtem Interesse vorgenommen, andere wiederum dürfen nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Sie können der Bearbeitung basierend auf berechtigtem Interesse jederzeit widersprechen sowie auch Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Mehr dazu finden Sie unter Einstellungen.
Wenn Sie auf "Akzeptieren" klicken oder dieses Fenster schliessen, stimmen Sie den genannten Datenbearbeitungen durch uns und Dritte zu. Klicken Sie auf Einstellungen finden Sie mehr Informationen zu den Datenbearbeitungen und zu unseren IAB-Partnern und können dort auch jederzeit Ihre Präferenzen ändern.
Возможно, сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова.
Если вы не можете загрузить ни одну страницу – проверьте настройки соединения с Интернетом.
Если ваш компьютер или сеть защищены межсетевым экраном или прокси-сервером – убедитесь, что Firefox разрешён выход в Интернет.
Firefox не может установить соединение с сервером www.caritas.de.
Отправка сообщений о подобных ошибках поможет Mozilla обнаружить и заблокировать вредоносные сайты
Сообщить
Попробовать снова
Отправка сообщения
Сообщение отправлено
использует защитную технологию, которая является устаревшей и уязвимой для атаки. Злоумышленник может легко выявить информацию, которая, как вы думали, находится в безопасности.
captions and subtitles off , ausgewählt
OGV - High OGV - Low OGV - High OGV - Low
Schrift Farbe weiß schwarz rot grün blau gelb magenta türkis Durchsichtigkeit undurchsichtig halbdurchsichtig Hintergrund Farbe schwarz weiß rot grün blau gelb magenta türkis Durchsichtigkeit undurchsichtig halbdurchsichtig durchsichtig Fenster Farbe schwarz weiß rot grün blau gelb magenta türkis Durchsichtigkeit durchsichtig halbdurchsichtig undurchsichtig
Schriftgröße 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% Textkantenstil kein erhaben gedrungen uniform mit Schlagschatten Schriftfamilie Proportionale Sans-Serif Monospace Sans-Serif Proportionale Serif Monospace Serif Handschrift Schreibschrift Großbuchstaben
Zurücksetzen Alle Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen Fertig
Der Webtalk ist nun beendet, vielen Dank für eure Beteiligung! Hier könnt ihr euch die Aufzeichnung des Talks anschauen:
Anfang des Dialogfensters. Esc bricht ab und schließt das Fenster.
Was ist das eigentlich, Alltagsrassismus? In welchen Situationen manifestiert er sich und wie kann man ihm begegnen? Julius Franklin von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD) und Nuran Yiğit vom Migrationsrat Berlin im Dialog mit Schülerinnen und Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Berlin Neukölln.
Viele Menschen in Deutschland sind täglich Alltagsrassismus ausgesetzt – in der Schule, am Arbeitsplatz, im Bus, auf der Straße. In einem interaktiven Webtalk diskutierten hier im Livestream Externer Link: Julius Franklin von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD) und Externer Link: Nuran Yigit vom Migrationsrat Berlin , wie sich Alltagsrassismus äußert und was man dagegen tun kann. User konnten mitreden per Hashtag #wokommstdudennher und sich live dazuschalten am 17. November 2014 ab 11.50 Uhr auf Interner Link: bpb.de/Alltagsrassismus .
Moderation: Hadija Haruna (M) Nuran Yigit: NY Julius Franklin: JF SchülerInnen: S
M: Herzlich willkommen zum interaktiven Webtalk der Bundeszentrale für politische Bildung. Heute nicht aus dem Studio, sondern live in der Albert-Schweitzer-Schule in Berlin. Ein ganz herzliches Willkommen daher an euch hier in der Aula an die Schüler. Mein Name ist Hadija Haruna und unser Thema heute ist: Wo kommst du denn her? Über Alltagsrassismus – [Gong] wir sind in einer Schule – in Deutschland. Wir warten kurz.
Der Talk findet wie gesagt in Kooperation mit der Albert-Schweitzer-Schule statt und hier haben ganz viele Schüler zum Thema gearbeitet und von denen hören wir später dann auch mehr. Außerdem werde ich in den kommenden anderthalb Stunden hier mit den Experten auf dem Podium sprechen und ich freue mich, sie erst mal vorstellen zu können. Ich beginne hier zu meiner Rechten, das ist Nuran Yigit. Nuran Yigit ist Diplom-Pädagogin und war ganz lange Zeit Leiterin im Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des Türkischen Bundes Berlin-Brandenburg, arbeitet als Empowerment-Trainerin und ist aktuell Vorstand beim Migrationsrat Berlin-Brandenburg.
Ganz außen sitzt Julius Franklin, er ist Vorstandsmitglied der ISD, das ist die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Er ist Filmemacher in Berlin und innerhalb der ISD unterstützt er verschiedene Projekte, unter anderem die Kampagne Stop Racial Profiling, außerdem das Filmprojekt Rheinland. Und er ist außerdem Teil des Web-Teams und betreut die Politgruppe der ISD Berlin. Meine Wenigkeit – ich bin freie Print-Journalistin und Redakteurin im Hessischen Rundfunk und meine Schwerpunktthemen sind Jugend, Migration und Rassismusforschung.
Bevor wir loslegen, der Aufruf an euch: Ihr könnt euch einbringen. Stellt den Experten hier auf dem Podium direkt eure Fragen oder macht Anmerkungen auf Facebook oder Twitter unter dem Hashtag #wokommstdudennher. Oder direkt auf der Seite der Bundeszentrale, dort könnt ihr direkt unter dem Livestream eure Kommentare einbringen und bei den Umfragen mitmachen.
Fangen wir an. Rassismus – wir wollen heute über Alltagsrassismus sprechen, aber da sollten wir erst mal vorher kurz darüber sprechen, was Rassismus überhaupt ist. Viele benutzen ja diesen Begriff nicht so wirklich gerne, weil er ein bisschen Scham auslöst oder man irgendwie die Sorge hat, nicht rassistisch zu sein. Deswegen erscheint er für viele als kein guter Begriff, ihn zu benutzen. Viele benutzen dann eher Begriffe wie Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit. Rassismus wird auch gerne mal als Einzelfall betitelt oder "manche Leute sind einfach zu empfindlich". Leider sieht es in der Realität anders aus. Viele Wissenschaftler sprechen davon, dass es verschiedene Rassismusformen gibt, weil es geschichtlich gesehen eben ganz viele verschiedene Rassismen gab, die bis heute wirken. Und die Wissenschaftler sagen zum Beispiel auch, dass Kinder mit bestimmten Bildern und Vorstellungen aufwachsen, die sie bis heute prägen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Alltagsrassismus: Alltagsrassismus bedeutet ja, überall und täglich. Julius und Nuran, erzählt mir, was bedeutet Alltagsrassismus in euren Augen.
JF: Alltagsrassismus, das sind Rassismen, die uns im täglichen Leben begegnen. Das kann in jeder Situation entstehen, in der Schule, auf der Straße, beim Arbeitsplatz, beim Besuch beim Arzt, beim Einkaufen. Das sind Situationen, in denen uns Rassismus begegnet und das nennt man Alltagsrassismus.
NY: Ergänzend würde ich auch sagen, um es noch mal zu spezifizieren, es geht darum, dass Menschen zu "Anderen" gemacht werden, sie entsprechen dann sozusagen nicht dem Normalverständnis, sie sehen nicht so aus wie "normale Deutsche" aussehen oder sie haben einen anderen Namen, sie haben einen Akzent oder sie haben eine andere Religion. Es wird etwas genommen, das wird markiert als etwas anderes, damit man eine Trennung zwischen Wir – also die Normalität, die normale Gesellschaft – und die – die anderen, die anders aussehen oder anders sprechen oder wie auch immer... Das ist dann das, was im Alltag immer wieder hochkommt, wie zum Beispiel "Wo kommst du eigentlich her?". Das ist der bekannte Herkunfts-Check, wo kommst du eigentlich her. Und wenn man dann sagt, ich komme nirgendwo her, ich komme hier aus Berlin - "nee, nee, wo kommst du eigentlich her?". Oft wird damit gemeint, ich bin ja auch neugierig, ich möchte gerne wissen, wo du herkommst, aber wenn man ein bisschen tiefer rein guckt, ist es gar nicht wirklich die Neugier, sondern es ist die Verfestigung von diesem Bild: du siehst anders aus, also gehörst du hier nicht dazu, also musst du ja von irgendwo anders herkommen. Und da würde ich mir wünschen, dass das aufgebrochen wird, weil Deutschland eben nicht mehr weiß – also "weiß" als Begriff, da kommen wir vielleicht nochmal dazu – sondern eben ganz unterschiedlich ist.
M: Also noch mal zusammengefasst, dieses normal und nicht normal – normal ist ja, was ist die Norm, wer sagt überhaupt, was normal ist. Hast du, Julius, noch andere Beispiele, wo man Alltagsrassismus erlebt ganz konkret?
JF: Das hängt eben vom Normverständnis ab, weil die deutsche Gesellschaft davon ausgeht, dass Deutschland ein weißes Land ist, wie du schon gesagt hast, Nuran. Da bekommt man dann oft zu hören "du sprichst aber gut deutsch", wenn man nicht dieser Norm entspricht. Solche Geschichten. Man schafft es auch schwerer, in Clubs zu kommen, auch bei der Polizei wird man öfter kontrolliert – Stichwort Racial Profiling, da kommen wir später bestimmt auch noch darauf. Also diese Situationen. Auch in völlig absurden Situationen, beim Einkaufen, wo es eben überhaupt keine Rolle spielt, wie ich aussehe, wo ich herkomme, dass dann Leute einem begegnen, wo kommst du eigentlich her, du siehst aber anders aus, wo sind denn deine Wurzeln, du sprichst aber gut deutsch. Diese alltäglichen Sprüche.
M: Also markiert werden. Ich würde gerne wissen, was bedeutet das denn, markiert zu werden, also was macht das mit einem vom Gefühl her, beständig erklären zu müssen, wer man ist, woher man kommt, warum man so spricht oder so gut deutsch spricht. Was macht Markierung mit einem?
NY: Ich kann vielleicht ein Beispiel von gestern erzählen im Zug. Ich saß da und der Platz war reserviert und dann sprach mich der Herr auf Englisch an und versuchte mir zu erklären in seinem Englisch, dass dieser Platz reserviert sei. Ich habe dann auf Deutsch geantwortet und er meint, ach Sie sprechen ja deutsch. Ich so, warum nicht? Also, es war eine ganz komische, irritierende Situation für beide Seiten. Was hat das mit mir gemacht? Mit mir hat das in dem Augenblick gemacht "Das kann doch nicht sein". Mich hat es in dem Augenblick erst mal irritiert und dann hat es mich aber auch wütend gemacht. Man kann doch erst mal ganz normal auf Deutsch fragen und wenn man merkt, dass diese Person vielleicht doch aus dem "Ausland" kommt, das passiert ja auch mal, dann kann man es ja auf Englisch versuchen, aber gleich von vornherein die Zuschreibung "sie sieht nicht deutsch aus, also kann sie kein Deutsch". Das war sehr irritierend und am Ende auch ein bisschen lustig für meine Sitznachbarin, die dann gelacht hat und gedacht hat, äh, was passiert hier jetzt gerade?
M: Das war jetzt eine persönliche Geschichte, aber ihr arbeitet ja auch mit vielen Menschen zusammen, die immer wieder die gleichen Erfahrungen machen. Was ist da eure Erfahrung, ich sage mal, auf einer übergeordneten Metaebene? Was sind da eure Erkenntnisse, was macht Markierung, Fremdmarkierung?
JF: Es ist schwierig, sich zugehörig zu fühlen zu dieser Gesellschaft. Ich zum Beispiel bin hier geboren, bin hier aufgewachsen, ich sehe das als meine Heimat. Und es ist immer schwierig, dann immer als anders betrachtet zu werden von dieser Gesellschaft, von der man eigentlich ein Teil ist und Teil sein möchte. Es ist auch eine Ohnmacht in den Situationen, wenn man oft nicht weiß, wie soll man reagieren. So geht es auch anderen Menschen, man sitzt dann erst mal und ist völlig verwundert, was passiert mir gerade, wie kommt diese Person überhaupt auf die Idee, mir so zu begegnen? Ich würde schon sagen, das ist schwierig, ein Ohnmachtsgefühl, Hilflosigkeit oft und dann natürlich Wut. Im besten Fall, wenn man gelernt hat, wie man damit umgeht, kann man darüber lachen.
M: Wir haben ja eine Umfrage im Netz gestartet, die ging um Rassismus im Alltag, weil – wie man bei euch gehört hat, das ist ein Thema. [Ins Publikum] Wir kommen auch gleich zu euch, vielleicht ist das auch für euch ein Thema. Vielleicht auch für euch im Netz. Aber für manche ist das total schwer nachvollziehbar. Die sind eben auf der anderen Seite und machen diese Erfahrungen nicht. Und deswegen würde ich gerne von euch wissen: Was glaubt ihr, wie viele Befragte haben der Aussage zugestimmt "Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet."? Haben das 10 Prozent gesagt oder haben das 27,5 Prozent gesagt? Das frage ich euch im Netz und das frage ich auch euch [im Publikum]. Ihr habt so rote und grüne Karten in der Hand und die grünen Karten stehen für die 10 Prozent und die roten Karten für die 27,5 Prozent. Was glaubt ihr, wie viele Leute haben gesagt 27,5 Prozent und 10 Prozent? Einfach mal Karten nach oben. Also, ihr könnt es sehen, die Mehrheit geht davon aus, dass 27,5 Prozent das gesagt haben, außer zwei in der Mitte. Jetzt würde mich wirklich interessieren, ihr seid so rausgefallen, warum glaubt ihr 10 Prozent, was ja bedeutet, wenig? Da kommt ein Mikro. Einfach, was euch spontan einfällt, warum ihr glaubt, dass es nur 10 Prozent sind.
S1: Naja, man geht am Anfang immer davon aus, das ist auf jeden Fall viel, aber ich denke, das ist einfach meine Meinung, wie ich die Menschen kenne und deswegen denke ich 10.
S2: Also ich würde das auch geringer einschätzen, weil ich denke, dass viele inzwischen darüber sprechen und vielleicht jetzt auch von dieser Meinung abkommen. Deswegen würde ich das so gering einschätzen.
M: Und möchte jemand was von den 27,5-ern sagen? Warum sie glauben, so "viel"? Nur Mut! Magst du was sagen? Gut, soll ich es auflösen? Dann löse ich es auf. Leider muss ich euch beiden sagen, es sind die 27,5 Prozent, die gesagt haben, dass viele Ausländer Deutschland in einem gefährlichen Maß überfremden. Warum wir diese Umfrage eingeblendet haben, ist natürlich, um deutlich zu machen, was ist für eine Stimmung im Land. Es gibt auch Studien, die sagen, der Rassismus kommt nicht nur von rechts, sondern er kommt aus der Mitte, er ist täglich unter uns, und darüber sprechen wir ja auch. Wir haben jetzt ein paar alltagsrassistische Beispiele von euch gehört und ich habe vorhin eine kleine Einführung gemacht, was könnte Rassismus bedeuten, das ist ja sehr abstrakt. Wir wollen hier ja verstehen, wie Rassismus funktioniert. Deswegen die Frage an euch: Wie funktioniert Rassismus in unseren Köpfen? Gerne auch konkret an Beispielen, also wie sind die Mechanismen?
JF: Rassismus ist ja eine Ideologie, die entstanden ist, als Menschen kategorisiert wurden. Man ging davon aus, dass Menschen verschiedenen "Rassen" angehören und da wurden sie in verschiedene Kategorien gesteckt und jede Kategorie hat eine Zuschreibung von Merkmalen bekommen, also bestimmte Stereotype, die sich heute noch hartnäckig halten. Die Theorie ist noch nicht so alt im Verhältnis gesehen und es ist sehr schwierig, das aufzubrechen, obwohl die Wissenschaft schon seit mehreren Jahren erwiesen hat, dass es eigentlich keine "Rassen" gibt unter Menschen, sondern nur eine menschliche Rasse in dem Sinne. Und ich glaube, dass diese Stereotype, die ja immer noch durch die Medien verbreitet werden, sich sehr hartnäckig in den Köpfen halten.
NY: Ich denke anschließend daran, dass wir das sozusagen als Erbe in unserer Gesellschaft mittragen. Wir wissen heute alle, es gibt keine "Rassen", aber es gibt dieses Denken immer noch. Und das ist von Generation zu Generation weitergegebenes Denken in Sprache, in Wissen, es wird alles reproduziert, wir saugen das quasi mit der Muttermilch schon auf. Wenn wir geboren werden in diese Gesellschaft, die so strukturiert ist, die rassistisch strukturiert ist, dann lernen wir das auch, wir verinnerlichen das und dann verhalten wir uns auch dementsprechend.
M: Wie lernt man das denn? Wie muss ich mir das vorstellen? Was lerne ich denn da für Beispiele, dass ich weiß, z
Schwanz von zwei Ludern aufgereizt
Geile Schülerin bekommt, was sie wollte
Interracial Arschficken - Schwarzer Fickt Model Ava Delush Hart In Den Arsch - Pornhub Deutsch