Goldene Arbeiter
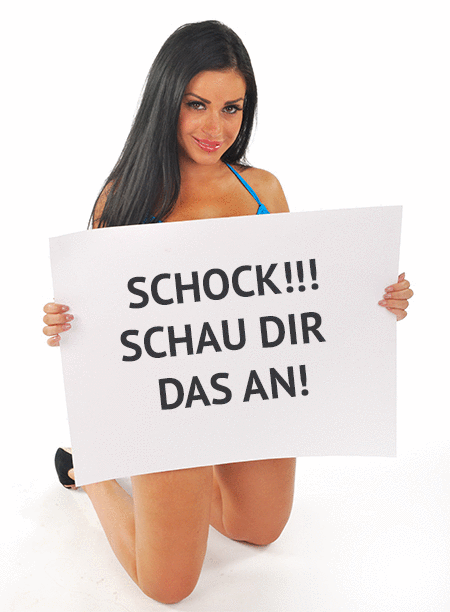
🔞 ALLE INFORMATIONEN KLICKEN HIER👈🏻👈🏻👈🏻
Goldene Arbeiter
2. Weltkrieg
Orden / Medals
Uniformen / Uniforms
Stahlhelme Schirmmützen Schiffchen / Steel helmets / Visor hats / caps
Dolche Säbel Bajonette / Daggers and swords
Wehrpass / Soldbuch / Ausweise // Militarypass - Documents
Effekten Uniform und Mützenabzeichen / badges and Cloth uniform badges
Koppel Koppelschlösser / Buckles and belts WW2
Kleinabzeichen Miniaturen Tagungsabzeichen / Pins , badges and Miniatures
Ausrüstung Ersatzteile Technik Pistolentaschen Luger 08 / P38 Leder Beriemung / field gear
Bücher & Zigarettenbilder Alben / Books WW2
Partei NSDAP SA und diverse Plakate
Urkunden / Besitzzeugnis / Certificates
Feldspangen / Ribbon Bars
Fahnen Stander Wimpel Emailleschilder Schilder Plaketten
Porzellan Geschirr / Besteck / Wehrmacht Tabak
Dokumente / div. Papiere / Documents
Erkennungsmarken
Olympiade Olympische Spiele
Ringe Fingerringe 3. Reich
Ärmelbänder & Armbinden / Cufftitles & armbands
Medaillen & nichttragbare Plaketten Preise Schiesspreise
Foto / Postkarten / Fotoalbum / Ritterkreuzträger
1. Weltkrieg und Kaiserreich
Freikorps 1919 - 1924
Reservistenkrüge Grabenkunst Porzellan & Andenken
Ausland - Russland Sowjetunion USA Europa
Bajonette Ausland und Deutschland
Münzen Broschen Anhänger
Österreich KuK
Fahrzeuge Teile & Zubehör
Auf Lager innerhalb 3 Tagen lieferbar
Originale goldene Dienstboten und - Arbeiter Medaille München mit Urkunde München 1929, die Medaille ist Echt - Silber vergoldet 30mm mit 19 Gramm Gewicht in guten Zustand, die Schachtel dazu mit blauer Samteinlage in gut erhaltenen Zustand - nur der eiserne Drücker ist abgebrochen, die Schachtel lässt sich dadurch nicht mehr schliessen, die Urkunde doppel gefaltet mit Abnutzungen, Gesamt Zustand 2
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Benutzung dieser Seite stimmen Sie dem zu. Informationen darüber, wie wir Cookies verwenden, erhalten Sie hier .
> Weimarer Republik
Alltagsleben
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
© Chronos Film GmbH, aus: "Weltbühne Berlin"
Index der Lebenshaltungskosten 1924-1933
© Chronos Film GmbH, aus: "Weltbühne Berlin"
© Deutsches Historisches Museum, Berlin
Die Gesellschaft der Weimarer Republik war eine zutiefst gespaltene. Wirtschaftliche Not bestimmte in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg den Alltag eines Großteils der Deutschen. Dem auch während der ”Goldenen Zwanziger” grassierenden Elend der am Rande des Existenzminimums lebenden Arbeiterfamilien stand eine Kunst- und Kulturszene mit einem avantgardistischen Lebensstil kaum dagewesener Intensität gegenüber. Ebenso wie der Freizeit- und Vergnügungsbereich immer konkretere Formen annahm, wuchsen in einer durch Technikbegeisterung geprägten Zeit die Möglichkeiten der Kommunikation und der Motorisierung. Mit dem Automobil oder dem Motorrad, dem beliebtesten Verkehrsmittel der Weimarer Republik, unterwegs zu sein, bedeutete Unabhängigkeit und Flexibilität.
Die Folgen des Ersten Weltkriegs waren im Alltagsleben der Deutschen nach Kriegsende stets präsent. Kriegsversehrte prägten ebenso das Straßenbild wie unterernährte Kinder und Erwachsene, die nach den entbehrungsreichen Jahren der staatlichen Nahrungsmittelrationierung sehnsüchtig auf ausreichende Mahlzeiten und einen vollen Speiseplan hofften. Der chronische Mangel an Grundnahrungsmitteln förderte Hamsterfahrten und einen regen Schleichhandel, bei dem sämtliche Arten von Wertgegenständen gegen Kartoffeln, Eier, Mehl oder Zucker getauscht wurden. Arbeitslosigkeit sowie Hunger und soziales Elend führten zu einer Kriminalisierung des Alltags, bei dem im Kampf ums nackte Überleben Diebstähle von Lebensmitteln und Plünderungen von Geschäften mancherorts gravierende Ausmaße annahmen. Die galoppierende Inflation verschärfte 1923 die Situation und machte über Nacht Millionen vormals kaufkräftiger Bürger und von Vermögenszinsen lebender "Rentiers" zu Bettlern, während Spekulanten und Kriegsgewinnler ihren neuen Reichtum in Amüsierbetrieben schamlos zur Schau stellten.
Die psychologischen Folgen der Geldentwertung waren für einen Großteil der Deutschen ebenso tiefgreifend wie 1918 die unerwartete Kriegsniederlage, die das nationale Selbstwertgefühl verletzte. Massenvernichtung und Selbstbehauptung in den Materialschlachten prägten die Frontsoldaten ihr Leben lang. Das Kriegserlebnis kompensierten Millionen von ihnen in einem nachgemachten Soldatentum, zunächst in Freikorps, später in Kriegervereinen oder paramilitärischen Verbänden wie dem Stahlhelm . Andere schworen sich, nie wieder zu den Waffen zu greifen, und ereiferten sich für den Pazifismus.
Unter dem Motto "Nie wieder Krieg" versammelten sich Pazifisten alljährlich in Großstädten zu Massenkundgebungen. Demonstrationen und Aufmärsche verschiedenster politischer Gruppierungen, die durch Präsenz auf der Straße ihre Stärke beweisen wollten, gehörten ebenso zum alltäglichen Erscheinungsbild der Weimarer Republik wie die durch häufigen Wechsel der Regierungen bedingten monströsen Wahlagitationen der Parteien mit ihrer unüberschaubaren Anzahl von Flugblättern.
Wichtigste Informationsquelle für die Bevölkerung waren die ca. 3.400 im Deutschen Reich erscheinenden Tageszeitungen. Auflagenstärkste war mit 400.000 Exemplaren die "Berliner Morgenpost". In den publizistischen Vordergrund traten neuartige Zeitschriften und Illustrierte mit zahlreichen Bildreportagen. Das Bedürfnis nach visueller Erfahrung wurde auch von der Werbung befriedigt, die mit Leuchtreklamen, Werbefilmen oder mit großformatigen Plakaten und Anzeigen eine neue Form der Kommerzialisierung etablierte.
Der Alltag für weite Bevölkerungskreise wurde in den Zwanziger Jahren zunehmend von einer konsum- und freizeitorientierten Massenkultur bestimmt, die mit neuen Medien das Bedürfnis der Menschen nach Unterhaltung und Entspannung befriedigte. Mitte der Zwanziger gingen täglich etwa zwei Millionen Menschen in die Kinos . Ein finanzkräftiges Bürgertum besuchte die Opernhäuser und die Theater oder amüsierte sich in den zahlreichen Revuen der Großstädte. Ihren Vormarsch traten ab 1923 die Rundfunkgeräte an. Sportgroßveranstaltungen und Konzerte konnten durch Übertragungen einem Massenpublikum übermittelt werden. Zusammen mit Schallplatten förderte der Rundfunk die Verbreitung sich schnell abwechselnder Schlager und Tänze wie des Charleston oder des beliebten Shimmy.
Mit der Revolution von 1918/19 fielen die letzten noch bestehenden halbfeudalen Gesindeordnungen auf dem Lande. Dennoch hielt die im Kaiserreich einsetzende Landflucht und Urbanisierung in der Weimarer Republik an. Während der Bevölkerungsanteil der Großstädte bis 1933 auf ca. 30 Prozent anstieg, ging jener der Gemeinden mit weniger als 2.000 Einwohnern auf rund ein Drittel zurück. Parallel dazu reduzierte sich der Anteil der Erwerbspersonen in der Landwirtschaft gegenüber dem Kaiserreich um 4 auf knapp 30 Prozent. Seit den Zwanziger Jahren wurde das Land durch Elektrifizierung sowie durch die zunehmende Verbreitung des Telefons und des Rundfunks verstärkt in den Modernisierungsprozess miteinbezogen. Trotz des Aufkommens der Lastkraftwagen und des Ausbaus der Verkehrswege dominierte auf dem Lande noch immer das Pferdefuhrwerk als Lastentransportmittel. Zu der physisch anstrengenden Landarbeit ohne nennenswerte Unterstützung durch Maschinen gab es kaum Alternativen. Dampfpflüge oder Melkmaschinen konnten sich bestenfalls große Gutswirtschaften leisten; und die ersten, Ende der Zwanziger Jahre entwickelten Mähdrescher vermochten die während der Erntezeit eingesetzten Schnitterkolonnen nicht zu verdrängen.
Das harte Alltagsleben der Landbevölkerung mit im Sommer bis zu 18stündiger Arbeitszeit auf dem Felde spiegelte in keiner Weise die verbreitete "Agrarromantik" in der Weimarer Republik wider. Modernisierung und Fortschrittsglaube riefen als Gegenreaktion eine Rückbesinnung auf die Natur hervor. Dem Ruf "Zurück zur Natur" folgte die "auf Fahrt" gehende sozialdemokratische ebenso wie die Bündische Jugend , die als Pfadfinder oder Wandervögel singend und Gitarre spielend durch die Lande zog, um der städtischen Massenkultur und der "Amerikanisierung" des Alltagslebens zu entfliehen. Dennoch verwischte die Massenkultur vielfach die Milieugrenzen zwischen arm und reich, Stadt und Land, Arbeiterschaft und Bürgertum. Ins Kino gingen Menschen aller Klassen und Schichten, und sie alle sangen denselben Schlager oder lasen dieselben Boulevardblätter. Trotz des oft propagierten eigenständigen Milieus nahmen viele Arbeiter bürgerliche Riten an und an der Mode der Zeit teil. Der Mitte der Zwanziger Jahre im Bürgertum beliebte Strohhut ersetzte auch in Arbeiterkreisen vor allem an Sonntagen immer öfter die "Klassenbewusstsein demonstrierende" Schlägermütze.
Dennoch dominierten in der Weimarer Republik soziale und ideologische Klassengegensätze, die nach 1918 in den Parteien als Trägern der politischen Macht manifestiert wurden. Klassenbewusstsein prägte vor allem einen Großteil der Arbeiterschaft, die etwa 45 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung im Deutschen Reich ausmachte. Sie bildete in den Zwanziger Jahren das soziale Fundament von SPD und KPD . In einem dichten Netz von Organisationen und Vereinen entstand ein sozialistisches Milieu, das sich bewusst als Alternative zur bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Alltagsnormen verstand und das alltägliche Leben des Arbeiters "von der Wiege bis zur Bahre" begleiten wollte. Die Einführung des Achtstundentags ermöglichte es in der Weimarer Republik auch Arbeitern, sich nach Feierabend einer aktiven Freizeitbeschäftigung zu widmen. Arbeitergesangsvereine und der Arbeiter-Turn- und -Sportbund (ATSB) prägten das Freizeitverhalten dabei ebenso nachhaltig wie die besonders in der Arbeiterschaft beliebte Taubenzucht.
Trotz angehobener Stundenlöhne erreichte der Reallohn der unteren Einkommensschichten aufgrund stetig steigender Lebenshaltungskosten erst 1928 den Stand von 1914. Für die Arbeiter und kleinen Handwerker gab es kaum Möglichkeiten, ihren engen Wohnungen in den dunklen Mietskasernen der Großstädte zu entfliehen. In den städtischen Ballungszentren herrschte seit Kriegsende zudem eine verheerende Wohnungsnot. Die sprunghafte Steigerung der Eheschließungen in Deutschland zwischen 1918 und 1920 von 350.000 auf 900.000 hatte die prekäre Wohnungssituation ebenso verstärkt wie die Notwendigkeit der Unterbringung von annähernd 200.000 Flüchtlingsfamilien. Nur schleppend machte der Wohnungsbau in den ersten Nachkriegsjahren Fortschritte; trotz des 1924 beginnenden Baubooms überschritt die Anzahl fehlender Wohnungen im Deutschen Reich 1925 d
Riesiger Schwanz passt kaum in ihre enge Muschi
Sie macht es sich heimlich mit ihrem Vibrator
Milf Mutti fingert ihre Pussy bis zum Orgasmus