Ein Interview mit diesen Lesben
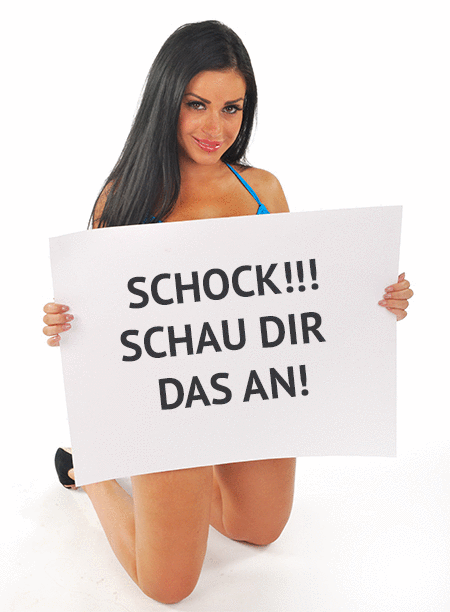
🔞 ALLE INFORMATIONEN KLICKEN HIER👈🏻👈🏻👈🏻
Ein Interview mit diesen Lesben
Der Tagesspiegel Gesellschaft Queer Interview mit Autorin und Aktivistin Katharina Oguntoye: „Die Frauen,- und Lesbenbewegung hat das Thema Rassismus in den Mainstream gebracht“
alle Antworten anzeigen Neueste zuerst Älteste zuerst Chronologisch
Katharina Oguntoye ist Historikerin, Aktivistin und Autorin. Sie hat die deutschen Frauen- und Lesbenbewegung sowie die afrodeutsche Bewegung maßgeblich geprägt.
Sie haben kürzlich das Bundesverdienstkreuz erhalten. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung? Das fühlt sich ziemlich gut an, aber auch unglaublich, denn ich habe nicht damit gerechnet, dass ich zu meinen Lebzeiten noch so eine Anerkennung bekommen würde. Meine Arbeit hat sehr lange außerhalb des Mainstreams stattgefunden. In den 1980er Jahren ging es in der Frauen- und Lesbenbewegung darum, überhaupt Sichtbarkeit zu erlangen. Und auch die Schwarze Bewegung war für Viele damals etwas ganz Obskures — so nach dem Motto „Rassismus — das gibt es bei uns nicht“.
Gab es solche Aussagen auch innerhalb der Frauen- und Lesbenszene, als Sie Anfang der 80er nach Berlin gekommen sind? Die Diskussion um Rassismus gab es da noch gar nicht. Als Schwarze Menschen in Deutschland lebten wir in Vereinzelung, den unreflektierten, kruden Rassismus erlebten wir voneinander isoliert. Auch in die deutsche Frauen- und Lesbenbewegung kam das Thema erst, nachdem Audre Lordes Texte übersetzt worden waren. Erst danach entwickelten wir überhaupt eigene Namen für uns, nannten uns Afrodeutsche oder Schwarze Deutsche und ersetzten damit Fremdbezeichnungen.
Auf Audre Lordes Anregung hin erschien 1986 ihr Sammelband „Farbe bekennen “ , den sie zusammen mit May Ayim herausgegeben haben. Was passierte danach? Die zehn Jahre danach waren sehr aufregend für die Schwarze Community: Plötzlich war es möglich, Dinge sichtbar zu machen und darüber zu sprechen. Wir haben viel Community-Building gemacht und untereinander Kontakte geknüpft. Gleichzeitig war ich weiterhin in der Frauen- und Lesbenbewegung engagiert, wo Rassismus plötzlich auch heftig diskutiert wurde.
Gab es auch Widerstände innerhalb der Frauen- und Lesbenbewegung, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen? Ich denke, dass das Thema überhaupt im Mainstream angekommen ist, ist ein Verdienst der Frauen- und Lesbenbewegung. Denn von dort strahlte es in die Gesellschaft, in den Mainstream hinein. Aber natürlich gab es auch Widerstände: Eine unserer ersten Veranstaltungen war 1987 auf den Berliner Lesbenwochen. Viele Frauen haben mich gefragt, warum wir uns ausgerechnet Afrodeutsche nennen wollen. Als Deutsche wurden sie im Ausland teilweise stigmatisiert.
Die Massenvernichtung von einem Teil der Bevölkerung, der Nachbarn und Freunde als eigene Geschichte zu ertragen, war nicht leicht. Aber bei diesem Deutsch-Sein geht es auch um Rechte, die uns Schwarzen Deutschen immer wieder abgesprochen wurden. Darauf wollten wir aufmerksam machen.
[Dieses Interview ist eine Auszug aus dem Queerspiegel-Newsletter, der alle zwei Wochen erscheint. Gratis-Anmeldung hier ]
Das Thema Antisemitismus war zu dieser Zeit schon länger bearbeitet worden. Nun kamen Migration und Rassismus als Themen hinzu… Auf Plakate und Transparente haben wir immer in wechselnder Reihenfolge „Schwarze, jüdische und migrantische Frauen“ geschrieben. Uns war wichtig, Migrationshintergrund, Jüdisch-Sein und Schwarz-Sein als Positionen gleichberechtigt, aber dennoch einzeln zu benennen, weil die verschiedenen Identitäten und Diskriminierungserfahrungen sonst unsichtbar gemacht worden wären.
Und uns war klar: Wenn wir es nicht schaffen, diese Themen zu bewältigen, dann wird die Frauenbewegung das nicht überleben. Und ein stückweit ist es ja auch so gekommen.
Was meinen Sie? Der Diskurs ist Mitte der 90er Jahre abgebrochen. Im Grunde waren wir damals gerade an dem Punkt, wo wir begriffen haben, dass Anti-Rassismus-Arbeit in Kooperation mündet: Wir wussten, wer wir waren, was unsere Verortung ist und unsere Identität. Der nächste Schritt wäre gewesen, Bündnisse mit anderen zu schließen: mit Schwulen und Männern, aber auch mit Frauen verschiedener Herkünfte oder körperlicher Fähigkeiten. Die Bewegung ist dann aber über das trans Thema gestolpert und letztendlich zum Halt gekommen.
Sie meinen den Ausschluss von trans Frauen? Heute werden ältere Feministinnen oft dafür beschimpft, dass sie trans Frauen ausgeschlossen hätten. Wenn ich in den Raum der anderen gehe, um zu kooperieren, ist das aber etwas anderes, als zu sagen „Dein Raum ist mein Raum“. Wir hatten uns gerade unseren Raum erkämpft — da war es schwer, ihn zu öffnen. Wir hätten darüber diskutieren müssen, doch dafür fehlten uns die Worte. Und dann ist die Lesbenwoche praktisch über das Thema explodiert, weil einfach keine Kommunikation mehr möglich war.
Was denken Sie heute, was das Problem war? Ich denke, das Problem war eine Starrheit, eine Nicht-Flexibilität, die dazu führte, dass die Frauen diese Unterschiedlichkeit nicht in ihre Arbeit und ihr Denken einbeziehen konnten. Es wäre vielleicht auch eine Lektion, die man daraus ziehen kann: Wenn ich kämpfe, dann muss ich radikal sein, um Schlagkraft zu gewinnen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch flexibel bleiben, sonst breche ich irgendwann. Flexibilität ist also genauso wichtig wie Radikalität.
Was würden Sie sich von der jungen queeren Generation wünschen? Ich habe nicht genau verfolgt, an welcher Stelle sich die queere Bewegung jetzt befindet. Aber ich denke, es geht darum, gut miteinander umzugehen und sich nicht in Wörtern zu verlieren. Jede Generation hat ihre eigenen Begrifflichkeiten. Natürlich ist es spannend, solche Unterschiedlichkeiten zu beleuchten und auszudiskutieren. Aber wichtiger sind die Gemeinsamkeiten: Wo kann ich gemeinsam kämpfen und Kräfte bündeln?
Und einiges hat die junge Generation in den letzten Jahren ja schon bewirkt, zum Beispiel was die Anerkennung von trans und inter Personen angeht. Das ist doch ein Erfolg! Jetzt muss es darum gehen, dass auch die Oma in Buxtehude versteht, was wir damit meinen. Und dass es nicht bei reinen Lippenbekenntnissen bleibt. Denn da fehlt die Analyse: Warum gibt es diese Form der Unterdrückung und wem nützt das etwas.
Sie haben gerade ein Crowdfunding gestartet. Wofür wird das Geld benötigt? Ich bin ich aufgrund einer Krebs- und Rheumaerkrankung seit ein paar Monaten auf einen Rollstuhl angewiesen und kann meine Wohnung im vierten Stock deshalb nur schwer verlassen. Eigentlich würden meine Partnerin und ich gerne in die Räume meines Vereins Joliba ziehen, die sich im Erdgeschoss befinden. Aber auch diese müssten erst kostenintensiv umgebaut werden. Dafür habe ich allerdings keine Rücklagen, denn als Aktivistin habe ich 25 Jahre lang ohne Gehalt gegen Rassismus, Sexismus und Homofeindlichkeit gekämpft.
Ich denke, dass jungen Leuten oft gar nicht bewusst ist, wie viele der Vorkämpfer*innen heute in schwierigen Situationen sind. Ich bin froh, dass ich ein sehr positiver Mensch bin und auch positiv in die Zukunft blicke. Und auch wenn ich nie Berufsausländerin werden wollte oder Lesbisch-Sein als politische Arbeit machen wollte, war mir immer klar: Das ist mein Leben, darüber gibt es gar keine Diskussion. Hier geht's zum Crowdfunding.
Bitte melden Sie sich zunächst an oder registrieren Sie sich, damit Sie die Kommentarfunktion nutzen können.
Der Tagesspiegel Gesellschaft Queer Interview mit Autorin und Aktivistin Katharina Oguntoye: „Die Frauen,- und Lesbenbewegung hat das Thema Rassismus in den Mainstream gebracht“
alle Antworten anzeigen Neueste zuerst Älteste zuerst Chronologisch
Katharina Oguntoye ist Historikerin, Aktivistin und Autorin. Sie hat die deutschen Frauen- und Lesbenbewegung sowie die afrodeutsche Bewegung maßgeblich geprägt.
Sie haben kürzlich das Bundesverdienstkreuz erhalten. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung? Das fühlt sich ziemlich gut an, aber auch unglaublich, denn ich habe nicht damit gerechnet, dass ich zu meinen Lebzeiten noch so eine Anerkennung bekommen würde. Meine Arbeit hat sehr lange außerhalb des Mainstreams stattgefunden. In den 1980er Jahren ging es in der Frauen- und Lesbenbewegung darum, überhaupt Sichtbarkeit zu erlangen. Und auch die Schwarze Bewegung war für Viele damals etwas ganz Obskures — so nach dem Motto „Rassismus — das gibt es bei uns nicht“.
Gab es solche Aussagen auch innerhalb der Frauen- und Lesbenszene, als Sie Anfang der 80er nach Berlin gekommen sind? Die Diskussion um Rassismus gab es da noch gar nicht. Als Schwarze Menschen in Deutschland lebten wir in Vereinzelung, den unreflektierten, kruden Rassismus erlebten wir voneinander isoliert. Auch in die deutsche Frauen- und Lesbenbewegung kam das Thema erst, nachdem Audre Lordes Texte übersetzt worden waren. Erst danach entwickelten wir überhaupt eigene Namen für uns, nannten uns Afrodeutsche oder Schwarze Deutsche und ersetzten damit Fremdbezeichnungen.
Auf Audre Lordes Anregung hin erschien 1986 ihr Sammelband „Farbe bekennen “ , den sie zusammen mit May Ayim herausgegeben haben. Was passierte danach? Die zehn Jahre danach waren sehr aufregend für die Schwarze Community: Plötzlich war es möglich, Dinge sichtbar zu machen und darüber zu sprechen. Wir haben viel Community-Building gemacht und untereinander Kontakte geknüpft. Gleichzeitig war ich weiterhin in der Frauen- und Lesbenbewegung engagiert, wo Rassismus plötzlich auch heftig diskutiert wurde.
Gab es auch Widerstände innerhalb der Frauen- und Lesbenbewegung, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen? Ich denke, dass das Thema überhaupt im Mainstream angekommen ist, ist ein Verdienst der Frauen- und Lesbenbewegung. Denn von dort strahlte es in die Gesellschaft, in den Mainstream hinein. Aber natürlich gab es auch Widerstände: Eine unserer ersten Veranstaltungen war 1987 auf den Berliner Lesbenwochen. Viele Frauen haben mich gefragt, warum wir uns ausgerechnet Afrodeutsche nennen wollen. Als Deutsche wurden sie im Ausland teilweise stigmatisiert.
Die Massenvernichtung von einem Teil der Bevölkerung, der Nachbarn und Freunde als eigene Geschichte zu ertragen, war nicht leicht. Aber bei diesem Deutsch-Sein geht es auch um Rechte, die uns Schwarzen Deutschen immer wieder abgesprochen wurden. Darauf wollten wir aufmerksam machen.
[Dieses Interview ist eine Auszug aus dem Queerspiegel-Newsletter, der alle zwei Wochen erscheint. Gratis-Anmeldung hier ]
Das Thema Antisemitismus war zu dieser Zeit schon länger bearbeitet worden. Nun kamen Migration und Rassismus als Themen hinzu… Auf Plakate und Transparente haben wir immer in wechselnder Reihenfolge „Schwarze, jüdische und migrantische Frauen“ geschrieben. Uns war wichtig, Migrationshintergrund, Jüdisch-Sein und Schwarz-Sein als Positionen gleichberechtigt, aber dennoch einzeln zu benennen, weil die verschiedenen Identitäten und Diskriminierungserfahrungen sonst unsichtbar gemacht worden wären.
Und uns war klar: Wenn wir es nicht schaffen, diese Themen zu bewältigen, dann wird die Frauenbewegung das nicht überleben. Und ein stückweit ist es ja auch so gekommen.
Was meinen Sie? Der Diskurs ist Mitte der 90er Jahre abgebrochen. Im Grunde waren wir damals gerade an dem Punkt, wo wir begriffen haben, dass Anti-Rassismus-Arbeit in Kooperation mündet: Wir wussten, wer wir waren, was unsere Verortung ist und unsere Identität. Der nächste Schritt wäre gewesen, Bündnisse mit anderen zu schließen: mit Schwulen und Männern, aber auch mit Frauen verschiedener Herkünfte oder körperlicher Fähigkeiten. Die Bewegung ist dann aber über das trans Thema gestolpert und letztendlich zum Halt gekommen.
Sie meinen den Ausschluss von trans Frauen? Heute werden ältere Feministinnen oft dafür beschimpft, dass sie trans Frauen ausgeschlossen hätten. Wenn ich in den Raum der anderen gehe, um zu kooperieren, ist das aber etwas anderes, als zu sagen „Dein Raum ist mein Raum“. Wir hatten uns gerade unseren Raum erkämpft — da war es schwer, ihn zu öffnen. Wir hätten darüber diskutieren müssen, doch dafür fehlten uns die Worte. Und dann ist die Lesbenwoche praktisch über das Thema explodiert, weil einfach keine Kommunikation mehr möglich war.
Was denken Sie heute, was das Problem war? Ich denke, das Problem war eine Starrheit, eine Nicht-Flexibilität, die dazu führte, dass die Frauen diese Unterschiedlichkeit nicht in ihre Arbeit und ihr Denken einbeziehen konnten. Es wäre vielleicht auch eine Lektion, die man daraus ziehen kann: Wenn ich kämpfe, dann muss ich radikal sein, um Schlagkraft zu gewinnen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch flexibel bleiben, sonst breche ich irgendwann. Flexibilität ist also genauso wichtig wie Radikalität.
Was würden Sie sich von der jungen queeren Generation wünschen? Ich habe nicht genau verfolgt, an welcher Stelle sich die queere Bewegung jetzt befindet. Aber ich denke, es geht darum, gut miteinander umzugehen und sich nicht in Wörtern zu verlieren. Jede Generation hat ihre eigenen Begrifflichkeiten. Natürlich ist es spannend, solche Unterschiedlichkeiten zu beleuchten und auszudiskutieren. Aber wichtiger sind die Gemeinsamkeiten: Wo kann ich gemeinsam kämpfen und Kräfte bündeln?
Und einiges hat die junge Generation in den letzten Jahren ja schon bewirkt, zum Beispiel was die Anerkennung von trans und inter Personen angeht. Das ist doch ein Erfolg! Jetzt muss es darum gehen, dass auch die Oma in Buxtehude versteht, was wir damit meinen. Und dass es nicht bei reinen Lippenbekenntnissen bleibt. Denn da fehlt die Analyse: Warum gibt es diese Form der Unterdrückung und wem nützt das etwas.
Sie haben gerade ein Crowdfunding gestartet. Wofür wird das Geld benötigt? Ich bin ich aufgrund einer Krebs- und Rheumaerkrankung seit ein paar Monaten auf einen Rollstuhl angewiesen und kann meine Wohnung im vierten Stock deshalb nur schwer verlassen. Eigentlich würden meine Partnerin und ich gerne in die Räume meines Vereins Joliba ziehen, die sich im Erdgeschoss befinden. Aber auch diese müssten erst kostenintensiv umgebaut werden. Dafür habe ich allerdings keine Rücklagen, denn als Aktivistin habe ich 25 Jahre lang ohne Gehalt gegen Rassismus, Sexismus und Homofeindlichkeit gekämpft.
Ich denke, dass jungen Leuten oft gar nicht bewusst ist, wie viele der Vorkämpfer*innen heute in schwierigen Situationen sind. Ich bin froh, dass ich ein sehr positiver Mensch bin und auch positiv in die Zukunft blicke. Und auch wenn ich nie Berufsausländerin werden wollte oder Lesbisch-Sein als politische Arbeit machen wollte, war mir immer klar: Das ist mein Leben, darüber gibt es gar keine Diskussion. Hier geht's zum Crowdfunding.
Bitte melden Sie sich zunächst an oder registrieren Sie sich, damit Sie die Kommentarfunktion nutzen können.
Tonight News > Unterhaltung > Promis > Lesbische Promis: Diese Stars hatten ihr Coming-out oder Outing
Lesbische Promis: Diese Stars hatten ihr Coming-out oder Outing
Viele lesbische Stars waren vor ihrem Coming-out mit einem Mann zusammen, andere machten nie ein Geheimnis daraus. Wir zeigen sie euch!
Das sind unsere aktuellen Schlagzeilen für euch!
TV-Moderatorinnen aus Deutschland, Schauspiel-Größen aus Hollywood oder international gefeierte Popstars – wir stellen Frauen des öffentlichen Lebens vor, die ihr Coming-out hatten:
Viele lesbische Stars waren vor ihrem Coming-out zunächst mit einem Mann zusammen. Einige homosexuelle Stars haben mit diesen sogar Kinder und entschieden sich dann aber, ihre sexuelle Orientierung öffentlich zu machen. Andere Stars machten hingegen nie ein Geheimnis aus ihrer Homosexualität oder Bisexualität. Wir zeigen euch die weiblichen Promis, die ihr Coming-Out hatten!
Foto: Denis Makarenko / Shutterstock.com
Die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin Beth Ditto geht seit jeher offen mit ihrer Homosexualität um. 2009 hatte sie mit ihrer Band „Gossip“ ihren internationalen Durchbruch mit dem Song „Heavy Cross“. Mitte 2013 heiratete Beth Ditto ihre Freundin Kristin Ogata auf Hawaii. Nachdem die gleichgeschlechtliche Ehe in den USA im Mai 2014 legalisiert wurde, heiratete das Paar zum zweiten Mal in Oregon. Gemeinsam mit der feministischen Autorin Michelle Tea veröffentlichte Ditto 2012 ihr autobiografisches Buch „Coal to Diamonds: A Memoir“.
Foto: taniavolobueva / Shutterstock.com
Cynthia Nixon wurde vor allem durch ihre Rolle der „Miranda Hobbes“ in der TV-Serie „Sex and the City“ bekannt und gehört zu den ganz großen TV-Stars in Hollywood. Unter anderem ihre Kolleginnen Sarah Jessica Parker und Kristin Davis zählen zu unseren heißesten Frauen über 40 – wer es noch ins Ranking geschafft hat, erfahrt ihr hier !
Die Schauspielerin, TV-Moderatorin und Autorin Ellen DeGeneres verliebte sich im Jahr 2004 in Portia de Rossi, bekannt aus der TV-Serie „Alley McBeal“. In ihrer Talksendung gab Ellen DeGeneres am 16. Mai 2008 bekannt, ihre Freundin heiraten zu wollen. Nur einen Tag vorher wurde das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe in Kalifornien aufgehoben. Im August des gleichen Jahres erfolgte die Trauung in Los Angeles. Auch Heidi Klum hat einen guten Draht zu DeGeneres – da kommen bei den Besuchen von Klum in ihrer Show auch gerne mal schlüpfrige Details zum Vorschein .
Foto: Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock.com
Die Fernsehmoderatorin und Komikerin Hella von Sinnen beteiligt sich seit vielen Jahren am Kampf gegen die Diskriminierung von Lesben und Schwulen und setzte sich für die Homo-Ehe ein. Lange Zeit war sie mit Cornelia Scheel zusammen, bis sie sich Ende 2015 trennten. Beide nahmen auch im Jahr 1992 an der „Aktion Standesamt“ des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland (LSVD) teil, woraus das mit der Musikband „Rosenstolz“ gemeinsam produzierte Lied „Ja, ich will“ entstand.
Die Pop- und Musicalsängerin Lucy Diakovska war Mitglied der deutschen Girlgroup „No Angels“. Im Jahr 2004 gab es ein überraschendes Liebes-Outing: Die bisexuelle Ex-DSDS-Teilnehmerin Juliette Schoppmann, die vorher mit DSDS-Teilnehmer Daniel Lopez liiert war, und Lucy machten ihre Beziehung öffentlich. Die Trennung erfolgte jedoch nach neun Monaten.
Die Moderatorin entschied sich im Jahr 2006 anlässlich ihrer neuen TV-Show „Glück-Wunsch – Vera macht Träume wahr“ sich zu outen. In einem Interview sprach sie erstmals über die Beziehung zu ihrer Lebensgefährtin. Im Jahr 2012 sollte die Hochzeit in Las Vegas folgen, jedoch entschloss sich Vera Int-Veen, diese abzusagen. Laut eigenen Angaben würden sich die beiden noch immer lieben und seien glücklich.
Der Blockbuster „X-Men: Der letzte Widerstand“ verhalf der kanadischen Schauspielerin Ellen Page den internationalen Durchbruch. Im Jahr 2014 outete sie sich in Las Vegas auf einer Konferenz der Human Rights Campaign als homosexuell. In einem Interview sprach Ellen Page sehr offen über ihre Probleme im Leben, bevor sie sich als „Lesbe“ outete. In einer Beziehung lebt sie seit 2017 mit der Tänzerin Emma Portner, die sie Anfang 2018 heiratete.
Foto: Denis Makarenko / Shutterstock.com
Die Twilight-Stars Kristen Stewart und Robert Pattinson waren einst ein Hollywood-Traumpaar. Im Jahr 2013 kam die Trennung, nachdem die Affäre zwischen Stewart und dem „Snow White and the Huntsman“-Regisseur Rupert Sanders bekannt wurde. Nachdem es Anfang 2016 bereits Gerüchte über Kristens Stewarts sexuelle Neuorientierung gab, bekannte sie sich im Juli dann offen zu ihrer Beziehung mit ihrer früheren Assistentin Alicia Cargile. In einem Interview erklärte die Schauspielerin, dass sie sich nicht festlegen wolle, ob sie heterosexuell, bisexuell oder lesbisch sei.
Übrigens: Vor einigen Jahren hat Stewart auf der Filmleinwand die Hüllen fallen lassen – welche Schauspielerinnen ebenfalls in Filmen Nacktauftritte hatten, zeigen wir euch hier !
Die Schauspielerin („Alles was zählt“) verkündete im August 2018 in ihrem Podcast „Busenfreundin“, dass sie auf beide Geschlechter steht. Ihre Kollegen und Freunde hätten es ohnehin schon länger gewusst, aber auch die Reaktionen ihrer Fans seien sehr positiv ausgefallen.
S
Lucy Tyler saugt und fickt hier wirklich sehr gerne mit einem alten Mann
Mercedes mit gigantischen melonen bekommt den fick
Blondes Teen hat das erste Mal einen Bukkake