Dienstmädchen erfüllt auch andere Dienste
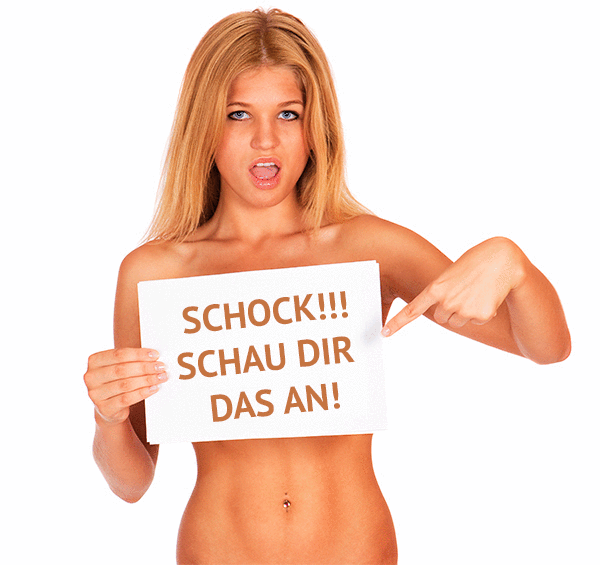
🔞 ALLE INFORMATIONEN KLICKEN HIER👈🏻👈🏻👈🏻
Dienstmädchen erfüllt auch andere Dienste
Возможно, сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова.
Если вы не можете загрузить ни одну страницу – проверьте настройки соединения с Интернетом.
Если ваш компьютер или сеть защищены межсетевым экраном или прокси-сервером – убедитесь, что Firefox разрешён выход в Интернет.
Firefox не может установить соединение с сервером www.boeckler.de.
Отправка сообщений о подобных ошибках поможет Mozilla обнаружить и заблокировать вредоносные сайты
Сообщить
Попробовать снова
Отправка сообщения
Сообщение отправлено
использует защитную технологию, которая является устаревшей и уязвимой для атаки. Злоумышленник может легко выявить информацию, которая, как вы думали, находится в безопасности.
Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch
↑ Harry M. Deutsch: Das Lied der Loreley. Roman über ein 1500jähriges Mysterium bis in die Gegenwart. Eisbär-Verlag, Berlin 1998 , ISBN 3-930057-47-6 , Seite 313.
↑ Siân Rees: Das Freudenschiff. Die wahre Geschichte von einem Schiff und seiner weiblichen Fracht im 18. Jahrhundert. Piper, München/Zürich 2003 , ISBN 3-492-23999-4 , Seite 15.
↑ Robert Harms: Das Sklavenschiff. Eine Reise in die Welt des Sklavenhandels. C. Bertelsmann Verlag, ohne Ort 2004 , ISBN 3-570-00277-2 , Seite 115.
↑ Hans Fallada: Jeder stirbt für sich allein. 7. Auflage. Roman. Aufbau, Berlin 2013 , ISBN 978-3-7466-2811-0 , Seite 23. Ausgabe nach der Originalfassung des Autors von 1947.
↑ Karl Heinz Bohrer: Granatsplitter. Erzählung einer Jugend. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2014 , ISBN 978-3-423-14293-9 , Seite 71. Erstausgabe 2012.
Seitenname: (z.B. amare bei amāre)
externes Linkziel: (z.B. amo bei amāre)
Qualifier: (z.B. literally, formally, slang)
Script template : (z.B. Cyrl for Cyrillic, Latn for Latin)
Zitatvorschau in
APA
MLA
Chicago
Harvard
©2004
Hausarbeit (Hauptseminar)
35 Seiten
Sofort herunterladen. Inkl. MwSt.
Format: PDF, ePUB und MOBI
– für alle Geräte
Versand in ca. 2-4 Werktagen national, internationaler Versand möglich
In der vorliegenden Arbeit soll sich mit den Lebens- und Arbeitsverhältnissen der häuslichen Dienstboten, vornehmlich der der Dienstmädchen um die Jahrhundertwende befasst werden. Es ist Ziel dieser Arbeit aufzuzeigen, dass diese gesellschaftliche Gruppe den Prozess der Verstädterung, der mit der Industrialisierung einherging, prägte.
Bevor sich aber mit den „sogenannten Dienstbaren Geistern“ auseinandergesetzt wird, soll der Frage nachgegangen werden, wie sich der Wandel von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft vollzogen hat bzw. vollzieht. Dabei wird zu untersuchen sein, inwieweit der steigende Wohlstand den Weg in die Welt der Dienstleistungsgesellschaft beschleunigt. Die Dienstmädchen, so die These, waren ein Beispiel für die im 19. Jahrhundert stattfindende Wohlstandsvergrößerung vom höheren Bürgertum auf das mittlere Bürgertum.
Der zentrale Teil dieser Arbeit wird sich mit den Lebensumständen und Arbeitsbedingungen befassen. Dabei soll untersucht werden, was die Anziehungskraft des Dienstmädchenberufes ausmachte, welche Erwartungen die Mädchen an die Arbeit im städtischen Haushalt richteten und wie die Realität sich oftmals darstellte. Die These hierbei ist, dass die Mädchen häufig in völliger Naivität vom Land in die Stadt gingen und viele der Erwartungen sich nicht erfüllten. Es soll in dieser Arbeit auch auf die Beziehungen der Mädchen mit den Herrschaften eingegangen werden sowie auf deren Arbeitszeit, Entlohnung, Unterbringung und Verpflegung. Wichtige Quellen, wenn man sich mit den Dienstboten beschäftigt, sind die Gesindeordnungen. Sie sorgten im Grunde bis 1918 für ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Dienenden und Herrschaften, dass in anderen Berufszweigen schon lange liberalisiert wurde. Deshalb soll der Behauptung nachgegangen werden, dass die Gesindeordnungen den Beruf des „Mädchens für Alles“ künstlich aufrecht erhalten haben.
Frauenarbeit in den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm und das Frauenbild des Bürgertums im 19. Jahrhundert.
Alte Jungfer und Hagestolz - Ledige Männer und Frauen im 19. Jahrhundert
Arbeit 4.0 und die Plattformökonomie in der digitalen Transformation der Arbeitswelt. Ist das plattformbasierte Arbeiten eine Grundlage für zukünftige Unternehmen?
Rollenverteilung und Machtgefüge in der bürgerlichen Familie um 1900
Integrationsprozesse deutscher Einwanderer nach Amerika im 19. Jahrhundert
Weibliche Emanzipation durch globale Arbeitsmigration am Beispiel deutscher Dienstmädchen in Amerika 1850-1914
"Schaffen wir den Mädchen ein menschenwürdigeres Dasein..." Die Dienstbotenfrage und ihre Lösungsansätze im gesellschaftlichen Diskurs um 1900
Die Kultur des Scheiterns. Auswirkungen in der Arbeitswelt
Arbeits- und konfliktreicher Alltag von Dienstmädchen im bürgerlichen Haushalt des 19. Jahrhunderts
Judenemanzipation in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert
Die vorindustrielle transatlantische Arbeitsmigration des späten 18. und frühen 19. Jahrhundert
Die "Soziale Frage" im 19. Jahrhundert
Kriegsende 1945: Der Film "Der Untergang" im Geschichtsunterricht
Alphabetisierung, Volksschulen und Gesellschaft zwischen 1800 und 1914 in Preußen
Arbeit im Zisterzienserorden. Die Norm und ihre Umsetzung im ersten Ordens-Jahrhundert
Holznotalarm im 18. und 19. Jahrhundert im deutschen Raume
Die englischen Parteien und das Parteiensystem vom 16. bis 19. Jahrhundert
Die sozio-ökonomische und sozio-kulturelle Situation des weiblichen Dienstpersonals im 19. und 20. Jahrhundert
Eigene Arbeiten hochladen
Hilfe/FAQ
Impressum
Datenschutz
AGB
Copyright © GRIN Publishing GmbH
powered by
Open Publishing
Lebensumstände und Arbeitsbedingungen
2. Der Wandel von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft
3. Dienstleistungsberufe in der Geschichte
4. Die Dienstbaren Geister des ‚langen 19. Jahrhunderts’
4.1. Der häusliche Dienst wird zum typischen Frauenberuf
4.2. Der Weg vom Land in die Stadt
4.3. Arbeiten und Leben der Dienstmädchen im ‚bürgerlichen Haushalt’
4.3.1. Die Arbeit im Haus
4.3.2. Die Arbeitszeit
4.3.3. Die Entlohnung
4.3.4. Die Unterbringung und Verpflegung
4.3.5. Gesindeordnungen, Dienstbotenbücher und andere Reglementierungswerke
Anlage 1 – Folie: Von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft.
Anlage 2 – Arbeitsblatt: Soziale Herkunft und Alterstruktur der Dienstmädchen in Berlin.
.Anlage 3 – Arbeitsblatt: Einkommen und Verdienst der Dienstboten im Kaiserreich.
In der vorliegenden Arbeit soll sich mit den Lebens- und Arbeitsverhältnissen der häuslichen Dienstboten, vornehmlich der der Dienstmädchen um die Jahrhundertwende befasst werden. Es ist Ziel dieser Arbeit aufzuzeigen, dass diese gesellschaftliche Gruppe den Prozess der Verstädterung, der mit der Industrialisierung einherging, prägte.
Da die Dienstboten ein Phänomen vom ausgehenden 18. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert waren, soll auf den von J. Kocka geprägten Begriff des „lange 19. Jahrhunderts“ zurück gegriffen werden.
Bevor sich aber mit den „sogenannten Dienstbaren Geistern“ auseinandergesetzt wird, soll der Frage nachgegangen werden, wie sich der Wandel von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft vollzogen hat bzw. vollzieht. Dabei wird zu untersuchen sein, inwieweit der steigende Wohlstand den Weg in die Welt der Dienstleistungsgesellschaft beschleunigt. Die Dienstmädchen, so die These, waren ein Beispiel für die im 19. Jahrhundert stattfindende Wohlstandsvergrößerung vom höheren Bürgertum auf das mittlere Bürgertum. Die heutige Dienstleistungsgesellschaft profitiert im wesentlichen von einer massiven Erhöhung des Wohlstandsniveaus aller gesellschaftlichen Schichten. Somit könnten die Dienstmädchen als Vorboten der Dienstleistungsgesellschaft gelten.
Allerdings wäre es falsch zu sagen, dass das Dienen bzw. Bedient werden ein Phänomen des 19. und 20. Jahrhunderts sei. Dienende und Bediente gibt es seit alters her. Dennoch wird zu fragen sein, welchen Unterschied es z.B. zwischen dem landwirtschaftlichen Gesinde und den Dienstboten gab.
Der zentrale Teil dieser Arbeit wird sich mit den Lebensumständen und Arbeitsbedingungen befassen. Dabei soll untersucht werden, was die Anziehungskraft des Dienstmädchenberufes ausmachte, welche Erwartungen die Mädchen an die Arbeit im städtischen Haushalt richteten und wie die Realität sich oftmals darstellte. Die These hierbei ist, dass die Mädchen häufig in völliger Naivität vom Land in die Stadt gingen und viele der Erwartungen sich nicht erfüllten.
Es soll in dieser Arbeit auch auf die Beziehungen der Mädchen mit den Herrschaften eingegangen werden sowie auf deren Arbeitszeit, Entlohnung, Unterbringung und Verpflegung. Wichtige Quellen, wenn man sich mit den Dienstboten beschäftigt, sind die Gesindeordnungen. Sie sorgten im Grunde bis 1918 für ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Dienenden und Herrschaften, dass in anderen Berufszweigen schon lange liberalisiert wurde. Deshalb soll der Behauptung nachgegangen werden, dass die Gesindeordnungen den Beruf des „Mädchens für Alles“ künstlich aufrecht erhalten haben.
Nachdem die Vielfältigkeit des Themas „Dienstbare Geister“ bzw. Dienstmädchen in der Arbeit deutlich gemacht wurde, soll sich in einem letzten Teil damit befasst werden, wie die dargestellten Inhalte im Unterricht gewinnbringend umgesetzt werden können. Die dazu nötige didaktische Analyse soll sich an den fünf Fragen orientieren, welche Klafki einst dazu formulierte. Abschließend ist es Ziel einige Überlegungen anzustellen, wie das Thema in der Unterrichtspraxis behandelt werden könnte.
Zum Forschungsstand sei soviel gesagt, dass erst seit den 70er Jahren, im Zuge des einsetzenden Perspektivenwechsels, die Lage der Dienstmädchen im Rahmen der historischen Frauenforschung untersucht wird. Die Forschung greift dabei auf zeitgenössische Quellen (z.B. Brief, Haushaltsbücher), Zeitzeugenbefragungen und individuelle Erfahrungsberichte zurück. Der Vorteil Lebensgeschichtlicher Forschungen liegt darin, dass sie Gesellschaftsgeschichte, Politik, Kultur und soziale Verhältnisse wiederspiegeln und so eine sinnlich greifbarere Geschichtsschreibung ermöglichen.
Die Dienstmädchen und Dienstboten aus der Zeit um 1900 stehen symbolisch für eine Branche, welche im Verlauf des 20. Jahrhunderts zusehends an Bedeutung gewonnen hat. Nun wäre es verfehlt, zu behaupten, die dienende Schicht selbst ist verantwortlich für das Entstehen der Dienstleistungsgesellschaft. Vielmehr verdeutlichen diese Berufsfelder, dass es zu allen Zeiten der Geschichte Personen gegeben hat, die für andere dienen. Dass gerade im 19. Jahrhundert ein Anwachsen des Dienstpersonals zu verzeichnen ist, mag der Tatsache geschuldet sein, dass eine aufstrebende Schicht (aufstrebendes Bürgertum) zu mehr Reichtum und Ansehen gelangte. Dieses Vorhandensein von Geld bei einer immer größer werdenden gesellschaftlichen Schicht bewirkte, dass man zunehmend „niedrige Arbeiten“ von anderen erledigen ließ. Verstärkend kam hinzu, dass dieser Lebensstil bei den Zeitgenossen Beachtung und Bewunderung fand. Dieser Wandel hin zu den Dienstleistungen vollzog sich zunächst im häuslichen Rahmen und griff mit fortschreitender Industrialisierung und steigendem Wohlstand auf die gesamte Volkswirtschaft über.
Dieses eben vereinfacht beschriebene Modell nimmt Bezug auf den Strukturwandel, welcher „sich durch veränderte binnenwirtschaftliche wie internationale Nachfrage-, Angebots- und Wettbewerbsbedingungen und aus Produktivitätssteigerungen durch grundlegende technische Entwicklungen“ ergibt. [1]
Der Weg in die Dienstleistungsgesellschaft ist in westlichen Industrieländern besonders durch die Verschiebungen zwischen den Wirtschaftssektoren gekennzeichnet, welchen sich die Arbeitnehmer zuordnen lassen.
Die „Drei-Sektoren-Theorie“ von Jean Fourastié bzw. Colin Clark beschreibt diesen Wandel und verdeutlicht dessen Ursachen. Die Grundannahme ist jene, dass es zu einer Verlagerung des Schwerpunktes der Wirtschaft und Erwerbstätigkeit vom primären Sektor der Produktgewinnung (Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft), über den sekundären Sektor der Produktverarbeitung (Industrie und Handwerk, Bergbau und Energiewirtschaft – verarbeitendes Gewerbe), hin zum tertiären Sektor (private und öffentliche Dienstleistungen [Handel, Banken, Pflegedienste, staatl. Leistungen - ÖPNV]) kommt.
Während zu Beginn der Industrialisierung in Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch etwa 80 % der Beschäftigten im Primärsektor tätig waren, änderte sich dies im Zuge der Industrialisierung zu Gunsten des Sekundärsektors. Heute arbeiten weniger als 2 Prozent der Beschäftigten in der BRD im primären Sektor. [2] Gegenwärtig erleben wir eine erneute starke Ausweitung des Anteils der im tertiären Sektor Beschäftigten bei rückläufigem Anteil des sekundären Sektors. Gründe für den damaligen und heutigen Strukturwandel lassen sich im wesentlichen auf drei Punkte zusammenfassen. Zum einen der wissenschaftliche und technische Fortschritt, zum zweiten das Anwachsen der Bevölkerung und drittens das Anwachsen des Produktivvermögens (Realkapital). [3]
Vor dem Einsetzen der Industriellen Revolution, in der sogenannten Agrargesellschaft, diente die landwirtschaftliche Arbeit zur Deckung der Lebensbedürfnisse. Im Zuge des wissenschaftlich - technischen Fortschritts wurden die Arbeiten in der Landwirtschaft einfacher, weniger und billiger. Die Folge war, dass im landwirtschaftlichen Bereich viele Menschen ihre Arbeit verloren und in die entstehenden Fabriken und Städte abwanderten (Urbanisierung). Auch wenn die Tätigkeiten in der Industrie beschwerlich waren, das Einkommen und der Wohlstand stieg im Vergleich zur Agrargesellschaft allmählich an. Kennzeichnend für die Industriegesellschaft ist schließlich , dass mit steigendem Einkommen die Nachfrage nach industriellen (langlebigen) Erzeugnissen wächst. Nachdem auch hier ein gewisses Ausstattungsniveau erreicht wurde, beginnt die Nachfrage nach Freizeitgütern (Reisen, Unterhaltung) zu steigen. Der wachsende gesellschaftliche und staatliche Wohlstand führt in die Dienstleistungsgesellschaft. Hier kommt es zur verstärkten Nachfrage nach Diensten anderer Personen bzw. Unternehmen und zur Bereiststellung von Diensten durch den Staat (z.B. soziale Hilfen, Bildungswesen, Gesundheitswesen). [4] In diesem Zusammenhang nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, dass kleiner werdende Familien mit dafür verantwortlich sind, dass Dienstleistungen eher nachgefragt werden, als zu Zeiten der Großfamilie, wo die Familie sich gegenseitig mit Rat und Tat zur Seite stand. [5]
Die unsere Gegenwart prägende und wie eben gezeigt historisch gewachsene Dienstleistungsgesellschaft ist gekennzeichnet durch das zur Verfügung stellen von eigenen Fähigkeiten, Wissen, Möglichkeiten, Ressourcen und Produktionsmittel für andere Person, Gruppen oder Unternehmen. Dieses Dienen für andere hat seine Motivation in der Existenzsicherung und zudem ist zu beobachten, dass es eine starke Spezialisierung gibt. All diese Merkmale trafen, wie noch zu zeigen sein wird, auch auf die Dienstmädchen zu.
Dass die Menschen sich seit jeher gegenseitig unterstützten und gegenseitig bei der Verrichtung von Aufgaben halfen, steht außer Frage. In der Urgesellschaft dienten z.B. die flinken Jäger den anderen, die nicht in der Lage waren, sich mit Jagdprodukten zu versorgen. In der Antike gab es die Sklaven, die in den Haushalten unverzichtbare Arbeiten leisteten und im Mittelalter bzw. in der Frühen Neuzeit kann man die Mägde und Knechte als Vorboten der Dienstboten des 19. und 20. Jahrhunderts nennen.
Das Gesinde, wie man Mägde und Knechte bezeichnete, arbeitete in bäuerlichen oder handwerklichen Betrieben auf dem Lande. Dort lebten sie fest eingebunden in den Familienverband manchmal sogar ihr gesamtes Leben. In der Regel kamen die Kinder mit 14 Jahren zum Bauern, wo sie bis zur Hochzeit blieben und hart arbeiteten. Ende des 19. Jahrhunderts betrug so der Anteil der unter Dreißigjährigen über 80 %. Auffällig dabei ist, dass um so jünger die Kinder der Bauern waren, um so mehr Gesinde gab es auf dem Hof. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass sobald die Kinder im arbeitsfähigem Alter waren, sie auf dem Hof mit zur Arbeit heran gezogen wurden und so das Gesinde kostengünstig ersetzten.
Die meisten Mägde und Knechte stammten aus kleinen Bauern- oder Händlerfamilien, die kaum in der Lage waren, ihre vielen Kinder ausreichend zu ernähren und zu kleiden. Das „In-Dienst-Gehen“ war so weitverbreitet und gewissermaßen nötig. Die Aufgaben, welche das Gesinde erledigen musste, kannten kaum Grenzen. Alle anfallenden Aufgaben auf Hof oder Feld, in Stall oder Küche mussten erledigt werden. Aber im Unterschied zu den städtischen Dienstboten des 19. Jahrhunderts war es auf dem Lande normal, dass die Gutfamilie Hand in Hand mit ihrem Gesinde arbeitete. Eine geregelte Arbeitszeit gab es nicht, vielmehr bestimmte das Wetter die Arbeiten und bis wann diese erledigt sein mussten. Wurde ein Knecht unverhältnismäßig lang beansprucht, konnte es sein, dass dieser kündigte. Da die Nachfrage nach gutem Gesinde groß war, konnte es sich ein Bauer selten leisten, als Ausbeuter verschrieen zu sein. Kennzeichnend ist zudem, dass die Arbeitszeit der Mägde höher war, als die der Knechte. War nämlich die Arbeit unter freiem Himmel erledigt, begann für sie das Putzen, Waschen, Nähen, Butterrühren, Gänserupfen, Stricken usw. Diese zusätzlichen Tätigkeiten im Haushalt sind auch der Grund dafür, dass das männliche Gesinde über mehr Freizeit verfügte als die Mägde. Die geringe Entlohnung erfolgte nach Rang, Alter und Geschlecht, wobei Nahrung, Kleidung und Unterkunft ebenfalls als Lohn angesehen wurden.
Die fortschreitende Industrialisierung und die daraus resultierende Landflucht führte zu einem stetig sinkenden Anteil des ländlichen Gesindes. Heute gibt es im ländlichen Bereich kaum noch Dienstboten. Maximal finden sich noch Angestellte (Landarbeiter) auf traditionsreichen Gütern die für den privat wirtschaftenden Gutsbesitzer nach modernen arbeitsrechtlichen Bestimmungen arbeiten. [6]
Ein weiterer Beruf, der sich bis in die Gegenwart verfolgen lässt, ist der Beruf der Kontoristin. Kontoristinnen wurde im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung immer häufiger in den Fabriken eingesetzt. Die Mädchen waren oftmals nicht älter als 14 Jahre, als sie ihre Stellung annahmen. Sie verbrachten zwischen 10 und 12 Stunden mit mechanischem Schreiben in engen, kühlen, dunklen und feuchten Räumen, die oftmals nicht mehr als ein Holzverschlag waren. Für die Tätigkeiten der Kontoristin war keine Ausbildung nötig. Die Jungs hingegen, welche Kaufmänner werden wollten, absolvierten eine Lehre von drei Jahren. Dadurch blieb das Bildungsniveau der Mädchen häufig auf einem geringen Stand. Dies ‚menschlichen Schreibmaschinen’ waren so massiv von Arbeitslosigkeit bedroht, wenn sie wegen der schlechten Arbeitsbedingung
Der russische Geschäftsmann fickte seine Frau und ihre Freundin, während sie Krebs
Drei deutsche Luder fingern ihre nassen Mösen
Amateur Sex mit einem Jungen mit POV-Brille